Über bwp@
bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.
bwp@ 35 - Dezember 2018
Ökonomisierung in der Bildung und ökonomische Bildung
Hrsg.: , &
Eigennutzmaximierung als Richtschnur moralischen Handelns? Antithesen zu Homanns ökonomischer Wirtschaftsethik
Im Rahmen der Sektionstagung Berufs- und Wirtschaftspädagogik in Frankfurt 2018 hat Karl Homann einen Vortrag über die ökonomische Ethik gehalten. Es ist bemerkenswert, wie häufig diese Wirtschaftsethik vor allem im wirtschaftswissenschaftlichen Kreis in Anbetracht der vorhandenen kritischen Literatur an ihr dennoch unkritisch rezipiert wird. So findet sich z.B. im Lexikon der ökonomischen Bildung (May 2012) zum Thema Ethik lediglich ein einziger Eintrag, nämlich die ökonomische Ethik als Ethik der Marktwirtschaft. Auf andere Ethiken bzw. Wirtschaftsethiken wird nicht einmal verwiesen. Dies hat u.a. damit zu tun, dass neoklassische Grundlagen der Ökonomik als Ausgangspunkt dienen und damit scheinbar eine Ethik entstanden ist, welche das Durchsetzungsproblem als Kernproblem jeder ethischen und moralischen Handlung beseitigt hätte. Diese neoklassische Dominanz zeigt sich u.a. darin, dass die Definition von Wirtschaft im Lexikon ausschließlich der neoklassischen Nutzen- und Gewinnmaximierung folgt. Moralisches Handeln im Sinne der ökonomischen Ethik fordert demnach keine Mäßigung mehr, sondern wird scheinbar durch das eigene Vorteilsstreben befördert. Der systematische Ort der Moral liegt in den Rahmenbedingungen und nicht in der Verantwortung der Einzelperson. Das Streben nach dem eigenen Vorteil ist nicht mehr untugendhaft, das Durchsetzungsproblem der Moral scheint gelöst. Dieses Kernproblem der Moral jedoch konnte weder Schopenhauer noch Kant lösen – und es wird auch niemand lösen können. Auch Homann nicht.
Nach einer Vorbemerkung wird im zweiten Kapitel das Programm der ökonomischen Ethik mit ihren neoklassischen und spieltheoretischen Prämissen zusammenfassend dargestellt. Im dritten Kapitel erfolgt eine kritische Analyse. Im vierten Kapitel wird schließlich dargelegt, dass das Kernproblem darin liegt, dass ohne Individualethik keine Institutionenethik möglich ist und daher die persönliche Moral ein wesentlicher und nicht hintergehbarer Bestandteil der Moral und Ethik ist. Damit muss aufgrund der Freiheit des Individuums das Durchsetzungsproblem ungelöst bleiben.
Self-interest maximization as a guideline for moral action? Antitheses to Homann’s economic business ethics
On the occasion of the Vocational Education division's meeting in Frankfurt 2018, Karl Homann spoke about business ethics. Given the critical literature available on this topic, it is remarkable how rarely business ethics is received critically by economists in particular. The Lexikon der ökonomischen Bildung (May 2012), for instance, contains no more than a single entry on ethics, namely on economic ethics as the ethics of market economy. No reference is even made to other definitions of ethics or business ethics. Among other things, this can also be attributed to the fact that neoclassical foundations of economics are taken as the starting point, apparently resulting in a notion of ethics which would have done away with the implementation problem as the problem at the core of every ethical and moral act. Another evidence for neoclassical dominance are encyclopedia entries focusing only on benefit and profit maximization. Hence, moral action in the context of business ethics no longer calls for moderation but seems to be promoted by the individual's pursuit for advantages. Morality is now a matter of circumstances and not of individual responsibility. Striving for one's own advantage is no longer unvirtuous, and the implementation problem seems to have been solved. Yet not even the likes of Schopenhauer and Kant were able to solve this core moral problem – and no one will ever be able to solve it. Not even Homann.
After a short introduction the second chapter provides a summary of the programme of normative economic ethics with its neoclassical and game-theoretical premises. The third chapter deals with a critical analysis. Finally, the last chapter claims the main problem to be that institutional ethics also needs individual ethics. Hence, personal morality is an essential component of morality. In conclusion, to guarantee the freedom of the individual, the implementation problem must not be solved.
1 Vorbemerkung
„Das Gesamtwerk Karl Homanns ist ein Forschungsprogramm“ schreibt Pies (2010, 250) und deshalb solle man den Blick auf das kohärente Ganze des Werkes von Homann werfen und nicht versuchen, dort und da Inkonsistenzen herauszusuchen. Da in einem Aufsatz natürlich nicht das Ganze Werk Homanns wiedergegeben werden kann, fokussiere ich das Wesentliche und Typische der ökonomischen Ethik, wissend, dabei immer bestimmte Akzentuierungen vornehmen zu müssen. Dabei stütze ich mich wiederum auf Akzentuierungen, die Homann selbst in Beiträgen vorgenommen hat. Eigentlich ist die Debatte über Homanns Wirtschaftsethik bereits ausführlich im Kontext der Wirtschaftsethik geführt worden. Aßländer und Nutzinger (2010, 226) schreiben in der Einleitung ihres kritischen Beitrages zur ökonomischen Ethik in der Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik: „Ziel soll es dabei jedoch nicht sein, den alten ‚Schulenstreit‘ der deutschen Wirtschafts- und Unternehmensethik erneut aufleben zu lassen.“ Es gehe um „eine zwar wichtige, aber nun doch auch etwas in die Jahre gekommene Debatte, die an dieser Stelle nicht erneut geführt zu werden braucht“ (Aßländer/Nutzinger 2010, 226). Es gehe beiden in ihrem Beitrag darum, einen öffentlichen Diskurs über Ethik einzuleiten, den Karl Homann selbst einmahnt. Ich habe bereits mit meiner Habilitationsschrift (Tafner 2015) versucht, diesen Grundlagendiskurs stärker in die Wirtschaftspädagogik einzubringen, nachdem die Beck-Zabeck-Diskussion letztlich, wie bereits Zabeck (2002, 488f.) bemerkte, nur von wenigen Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaftspädagogik aktiv geführt wurde. Aufgrund meiner ausführlichen Darstellungen in meiner Habilitationsschrift (vgl. Tafner 2015, 233ff.) gehe ich in diesem Beitrag nicht auf die Beck-Zabeck-Kontroverse per se ein. Es geht mir viel mehr darum, inspiriert durch den Vortrag von Karl Homann anlässlich der DGfE-Tagung in Frankfurt 2018, Antithesen zu seiner ökonomischen Ethik aufzuzeigen, um damit einerseits einen weiteren kleinen Beitrag zur ethischen Diskussion in unserer Disziplin zu leisten und andererseits deutlich zu zeigen, dass Homanns Thesen sehr kritisch diskutiert werden und es gute – auch wirtschaftspädagogische – Gründe gegen die ökonomische Ethik gibt (vgl. Tafner 2015; 2018a; 2018b; 2019).
2 Homanns Programm der ökonomischen Ethik
Bevor das Programm Homanns einer kritischen Analyse unterzogen werden kann, muss das Programm vorgestellt werden. Zuerst werden die Prämissen erörtert (2.1), danach das Theoriengebäude (2.2), um anschließend die Grundzüge der Spieltheorie in Dilemma-Situationen und die Konsequenzen für die ökonomische Ethik darzulegen (2.3).
2.1 Prämissen der ökonomischen Ethik
Die ökonomische Ethik geht davon aus, dass Moral nicht gegen Wirtschaft ins Spiel gebracht werden soll: „Moral lässt sich nicht gegen die Funktionserfordernisse der modernen Wirtschaft zur Geltung bringen, sondern nur in ihnen und durch sie. Um dies deutlich zu machen, muss die Ethik in eine tragfähige Gesellschaftstheorie eingefügt werden: Nur so wird Moral vor der Donquichotterie mancher Literaten, Philosophen und Theologen bewahrt, die aus moralischen Idealen, die durchaus von mir geteilt werden, unmittelbar Handlungsanweisungen ableiten wollen.“ (Homann/Lütge 2002, 3) Eine Umsetzung der Moral könne heute nur dann erfolgen, wenn sich die Akteure „davon Vorteile versprechen können“ (Homann 2003, 45). Die Moral muss also im Sinne der Eigennutzmaximierung Vorteile bringen und in diesem Sinne ökonomisiert werden. Das hängt mit der Vorstellung von Ökonomik zusammen, welcher Homann folgt. Diese Ökonomik ist auch die Grundlage der ökonomischen Ethik: „Die Ökonomik befasst sich mit Möglichkeiten und Problemen der gesellschaftlichen Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil.“ (Homann/Suchanek 2005, 4) Die traditionelle abendländische Tugendethik aristotelisch-thomistischer Ausprägung hingegen geht von der Mäßigung aus. Die Wirtschaft vormoderner Gesellschaften folgte Nullsummenspielen, in dem der Reichtum des einen, die Armut des anderen war. Heute lebten wir – so Homann (2005, 205f.) – in einer Wachstumsgesellschaft, weshalb es auch tugendhaft sei, seinen eigenen Anspruch auf dieses Wachstum zu stellen. Jeder Mensch habe also das moralische Recht, seinen eigenen Vorteil zu verfolgen. Begrenzt wird dieses Vorteilsstreben nur durch die regulativen Rahmenbedingungen. Der systematische Ort der Moral sind die regulativen Rahmenbedingungen (Homann/Blome-Drees 1992, 20; siehe auch: Homann/Lütge 2002, 4, 27ff., Homann 2012, 216ff.) Moral ist „kein individuelles, sondern ein kollektives Unternehmen“ und das moralisch Unerwünschte kann „nicht länger auf böse Motive oder Charakterschwäche der Akteure wie Profitgier oder Egoismus zurückgeführt werden“ (Homann/Lütge 2005, 51). Zwar bleibe auch die persönliche Ethik vor allem dort, wo es keine Regelungen gebe, relevant, aber der systematische Ort der Moral sei die Rahmenordnung. Damit ist die Eigennutzmaximierung, wie immer sie sich auch ausprägt, moralisch legitim, solange es keinen Rechtsbruch gibt.
Individualethik spielt demnach eine untergeordnete Rolle – was Homann auf meinem kritischen Einwand anlässlich seines Vortrages in Frankfurt auch bestätigt hat. Sie übernimmt demnach ihre Funktion für das Aufstellen neuer Regeln und für Handlungen, die keiner Regelung unterliegen, sowie bei Markt- und Wettbewerbsversagen und in überschaubaren Kleingruppen (vgl. Homann/Lütge 2002, 35; Homann/Blome-Drees 1992, 120). Systematischer Ort der Moral bleibt die Rahmenordnung. „Wenn die Rahmenordnung sicherstellt, dass die ‚moralfreien‘ Aktionen der Unternehmen zum langfristigen Wohl der Allgemeinheit ausschlagen, ist die allein an ökonomischen Kalkülen orientierte Tätigkeit der Unternehmen grundsätzlich zustimmungsfähig und damit legitim.“ (Homann/Blome-Drees 1992, 39)
Dennoch sei das Individuum für sein eigenes Tun verantwortlich und müsse seine Entscheidungen legitimieren. Diese Sicht sei jedoch dann nicht hilfreich, wenn es um die Koordination von Wettbewerb und Markt ginge. „Das Grundproblem der Ethik besteht darin, dass sich Wettbewerb und Moral im Handlungsvollzug auszuschließen scheinen.“ (Homann 2012, 216) Wettbewerb und Moral seien aber in Einklang zu bringen, wenn zwischen der Rahmenordnung und dem Handeln innerhalb dieser Rahmenordnung unterschieden werde. Am besten ließe sich das nach Homann (2012, 216) am Beispiel des Fußballspiels zeigen: Die Spielregeln garantierten die Fairness im Spiel und der Schiedsrichter überwacht die Einhaltung dieser Regeln. Die Spielzüge unterliegen dem Wettbewerb. Die Metapher des Fußballspiels hat bei Homann einen wichtigen theoretischen Unterbau. Wer die ökonomische Ethik verstehen will, muss sich mit ein paar theoretischen Grundlagen seiner Ökonomik auseinandersetzen.
2.2 Das Theoriengebäude der ökonomischen Ethik
Es geht um eine totale, alles umspannende Vorstellung von Wirtschaft als eine „Vorteils-/Nachteils-Kalkulation“, allerdings komplexitätsreduziert als Theorie und Modell, die auch in „Fragen des Heiratens und generativen Verhaltens, der Diskriminierung, der Kriminalität und des Drogenkonsums, aber auch in Bereiche wie Politik und Bürokratie und dergleichen mehr“ hineinreicht (Homann/Suchanek 2005, 5). Dabei wird vom Werturteilspostulat Max Webers ausgegangen, um „die positive Forschung soweit wie irgend möglich voranzutreiben und sie nicht durch vorschnelle Normativität abzubrechen oder (normativistisch) kurzzuschließen“ (Homann/Suchanek 2005, 350). Wie im neoklassischen Standardmodell üblich, wird vom Homo oeconomicus ausgegangen, der ausdrücklich weder als Menschenbild „noch als normatives Ideal“ (Homann/Suchanek 2005, 373) verstanden wird, sondern als „theoretisches Konstrukt, das auf ganz bestimmte grundlegende Problemstrukturen der Ökonomik, nämlich Dilemmastrukturen, zugeschnitten ist“ (Homann/Suchanek 2005, 371). Mit der ökonomischen Methode werden „die Implementationschancen erwünschter Verhaltensmuster und die Chancen der Destabilisierung unerwünschter Verhaltensmuster“ analysiert (Homann/Suchanek 2005, 388). Damit wird die Ökonomik zu einem umfassenden Programm – ganz im Sinne Gery Beckers (vgl. Homann/Suchanek 2005, 382).
Es wird dabei von drei Theoriekomplexen ausgegangen, die zusammenspielen (Homann/Suchanek 2005, 20): die Handlungstheorie, die Interaktionstheorie und die Institutionentheorie. Die Ethik wird also nicht lebensweltlich fundiert, sondern neoklassisch, wirtschaftswissenschaftlich. Es wird also in die wertfreie Welt der Modelle eingetaucht, um diese Ethik zu begründen.
Die Handlungstheorie folgt dem methodologischen Individualismus der Neoklassik. Die Akteure im Modell verhalten sich wie der Typ Homo oeconomicus: „Die ökonomische Theorie folgt bei der Analyse dieser Handlungen dem Satz: Akteure maximieren ihren Nutzen unter Nebenbedingungen.“ (Homann/Suchanek 2005, 20)
Die Interaktionstheorie beschreibt, wie die Handlungen von zumindest zwei Akteuren abgestimmt werden. Da die Handlungen interdependent sind, kann es zu gemeinsamen Interessen oder zu Interessenkonflikten kommen. Das Problem der Ökonomik sei daher nicht die Knappheit, sondern der Konflikt. Hier ist nun die Unterscheidung zwischen Handlung und Handlungsbedingungen entscheidend (siehe Tab. 1).
Tabelle 1: Handlungen und Handlungsbedingungen
|
Handlungen |
Handlungsbedingungen |
|
Ziele Motive Interessen Mittel |
Natürliche Bedingungen Kulturelle und soziale Bedingungen Rechtliche Rahmenordnung |
|
SIND NICHT ZU BEEINFLUSSEN |
SIND ZU BEEINFLUSSEN |
Da die Akteure vom Typ Homo oeconomicus sind, können die Handlungen (Ziele, Motive, Interessen, Mittel) nicht beeinflusst werden, lediglich die Handlungsbedingungen sind veränderbar. Im Gegensatz zu kulturellen, sozialen und natürlichen Bedingungen, können rechtliche Rahmenbedingungen gestaltet werden. Da Akteure in diesem Modell ihren Nutzen unter Nebenbedingungen maximieren, können durch regulative Institutionen Handlungen beeinflusst werden. Das ist die Grundlage der Institutionentheorie: Durch regulative Institutionen können die Handlungen der Menschen gestaltet werden. Es geht dabei um das Finden von Institutionen, deren Einhaltung dazu führt, dass der Homo oeconomicus in seinen Handlungen durch die Handlungsbeschränkung ein Ergebnis zeitigt, das zum Wohlstand der Gesellschaft führt. Der Homo-oeconomicus-Test sorgt dafür, dass nur regulative Institutionen gesetzt werden, die dazu führen, dass beim Verfolgen des eigenen Vorteils der gesellschaftliche Wohlstand erhöht wird (vgl. Homann/Blome-Drees 1992, 93ff.). Um dies theoretisch zeigen zu können, werden spieltheoretische Überlegungen in Dilemma-Situationen eingeführt.
2.3 Die Bedeutung der Institutionenethik auf Basis der Dilemma-Situationen
Die Interaktionen können also vorteilhaft oder konfliktreich sein. „Das Grundproblem der Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil wird mit dem Begriff Dilemmastruktur bezeichnet. Eine Dilemmastruktur charakterisiert die Situation, in der Interessenkonflikte die Realisierung der gemeinsamen Interessen verhindern.“ (Homann/Suchanek 2005, 31f., Hervorhebung im Original). Für Homann/Suchanek (2005, 32) taucht damit das Problem der Ausbeutung auf. In einer Dilemmasituation entscheidet nicht nur das eigene Verhalten, sondern immer auch das Verhalten des anderen. Obwohl grundsätzlich eine Kooperation gewünscht wird, die beiden Akteuren einen Vorteil brächte, könne dies zu einer Defektion führen. Am besten lasse sich dies am Gefangenendilemma erklären.
Die Idee des Gefangenendilemmas baut auf das US-amerikanische Rechtssystem auf. Krimineller A und B werden festgenommen und die Polizei hat ausreichend Beweise, um die beiden wegen illegalen Waffenbesitzes ein Jahr ins Gefängnis zu bringen. Da es Hinweise gibt, dass die beiden einen Bankraub verübt haben, werden sie unabhängig voneinander verhört. Da sie das Verbrechen tatsächlich verübten, haben sie nun zwei Strategien: gestehen oder schweigen bzw. leugnen. Wenn sie schweigen, kooperieren sie – miteinander und nicht mit der Polizei! – und wenn sie gestehen, defektieren sie. Gesteht einer die Tat, so geht er frei, weil für ihn die Kronzeugenregelung zum Tragen kommt. Der andere, der schweigt bzw. leugnet (kooperiert), muss für 20 Jahre ins Gefängnis. Beide haben diese Möglichkeit. Gestehen beide, dann kommen sie für acht Jahr hinter Gitter, fassen also eine geringere Haftstrafe aus, weil sie ein Geständnis abgelegt haben. Damit handelt es sich um ein Dilemma, weil der Ausgang der Entscheidung nicht nur von der eigenen Wahlhandlung, sondern ebenso von der des anderen abhängig ist. „Die eigenen Entscheidungen führen also nicht direkt zu dem angestrebten Ergebnis, sondern werden die Entscheidungen des Mit- oder Gegenspielers ‚gebrochen‘ oder ‚verwässert‘“ (Bayertz 2006, 149) Außerdem sind die Interessen des anderen nicht eindeutig. Tabelle 2 zeigt mögliche Strategien (vgl. Mankiw 2001, 359f.).
Eine wesentliche Annahme in diesem Modell ist, dass es keine Absprachen zwischen den Kriminellen gibt. Da es sich um ein neoklassisches Modell handelt, wird von der zweckrationalen Eigennutzmaximierung ausgegangen. Die Spieltheorie geht in einem solchen Fall von einer dominanten Strategie aus (vgl. Mankiw 2011, 260). Beide wollen ihren eigenen Nutzen maximieren und gestehen. Im Verfolgen des zweckrationalen Eigennutzens erreichen sie jedoch nicht ihr Maximum, sondern kommen in eine schlechtere Situation: Weder gehen sie frei, noch erhalten sie nur ein Jahr, nein es werden für beide acht Jahre. Die Verfolgung der Eigennutzmaximierung führt zur Defektion und zu einem individuellen (und kollektiven) schlechten Ergebnis.
Tabelle 2: Entscheidungsmatrix im Gefangenendilemma
|
Krimineller A[1] |
|||
|
leugnen |
gestehen |
||
|
Krimineller B |
leugnen |
1/1 |
20/0 |
|
gestehen |
0/20 |
8/8 |
|
Zur Begründung der Institutionenethik in der ökonomischen Ethik wird die Idee des Gefangenendilemmas herangezogen. Homann und Suchanek (2005, 31ff.) verwenden abstrakte Werte in einer Auszahlungsmatrix. Hier wird eine auf Hume zurückgehende Variante verwendet (vgl. Bayertz 2006, 152f.): Zwei Bauern stehen vor der Alternative, sich gegenseitig bei der Ernte zu helfen oder nicht. Der volle Gewinn der Ernte kann nur eingefahren werden, wenn beide kooperieren, sie sich also gegenseitig bei der Ernte unterstützen. Die volle Ernte betrage 4 Einheiten, die Kosten für die Mithilfe bzw. Kooperation seien -1 Einheiten. Die sich ergebenden Handlungsmöglichkeiten mit ihren Folgen zeigt die Tabelle 3.
Tabelle 3: Auszahlungsmatrix zweier Bauern
|
Bauer A |
||||
|
Gemeinsam ernten |
Nicht gemeinsam ernten |
|||
|
Bauer B |
gemeinsam ernten |
3/3 |
-1/4 |
|
|
nicht gemeinsam ernten |
4/-1 |
0/0 |
||
Helfen sich die Bauern gegenseitig, dann fährt jeder eine Ernte von 4 ein und muss Kosten von -1 einsetzen. Es bleibt also ein Gewinn von je 3. Den größten Gewinn von 4 erzielt nun jener Bauer, der sich beim Einbringen der Ernte helfen lässt, aber danach dem anderen nicht hilft, also keine Kosten für die Kooperation verrichten muss. In diesem Fall kann der andere Bauer keine Ernte einfahren, musste aber Kosten von -1 tätigen. Diese Alternative haben beide Bauern. Das drittbeste Ergebnis (0) entsteht, wenn es zu keiner Zusammenarbeit kommt und die Ernte von niemand eingebracht wird. Das schlechteste Ergebnis (-1) erzielt jener Bauer, der den anderen half, selbst aber keine Hilfe erhielt. Das Problem ist nun also, dass ein Bauer einen Vertrauensvorschuss leisten muss und seine Arbeit für den anderen einsetzt, ohne sicher zu sein, dass der andere dies auch tun wird. Hume schreibt dazu: „Dein Korn ist heute reif, das meinige wird es morgen sein. Es ist für uns beide vorteilhaft, dass ich heute bei dir arbeite und du morgen bei mir. Ich habe keine Neigung zu dir, und weiß, dass du ebenso wenig Neigung zu mir hast. Ich strenge mich daher nicht um deinetwillen an; und würde ich um meinetwillen, d.h. in Erwartung einer Erwiderung bei dir arbeiten, so weiß ich, dass ich enttäuscht werden und vergeblich auf deine Dankbarkeit rechnen würde. Also lasse ich dich bei deiner Arbeit allein. Und du behandelst mich in gleicher Weise. Nun aber wechselt das Wetter; wir verlieren beide unsere Ernte vermöge des Mangels an gegenseitigem Vertrauen und der Unmöglichkeit, uns einer auf den anderen zu verlassen.“ (Hume 1978, 268)
Die Eigennutzmaximierung führt also auch hier zu einem sowohl individuellen – nur diese zählt in der neoklassischen Annahme – als auch kollektiven suboptimalen Ergebnis. Nun fragt sich Homann – nicht nur er, sondern auch viele andere, die sich damit beschäftigen –, wie ein eigennutzmaximierender Akteur zu einer kooperativen Handlung geführt werden kann, die er auch tatsächlich einhält. Wie bereits durch Hobbes ausgeführt, ist es notwendig, staatliche regulative Institutionen einzuführen. Die Einführung einer Sanktion führt dazu, dass auch der eigennutzmaximierende Akteur kooperiert. Am Beispiel der Bauern würde der Staat das Nicht-Kooperieren (Vertragsbruch) mit einer Geldstrafe von -3 Einheiten sanktionieren (vgl. Bayertz 2006, 152 ff.). Dann ergibt sich eine neue Matrix (siehe Tabelle 4).
Tabelle 4: Auszahlungsmatrix zweier Bauern mit regulativer Institution (Sanktionen)
|
Bauer A |
|||||
|
Gemeinsam ernten |
Nicht gemeinsam ernten |
||||
| Bauer B |
gemeinsam ernten |
3/3 |
-1/4-3=1 |
||
|
nicht gemeinsam ernten |
4-3=1/-1 |
0-3=-3/0-3=-3 |
|||
Bricht ein Bauer den Vertrag, dann bringt er die volle Ernte ein und muss die Strafe von -3 zahlen, es ergibt sich ein Gewinn von 1. Helfen beide nicht, dann gibt es keinen Ertrag, aber eine Strafe von -3. Unter der Annahme der nutzenmaximierenden Akteure wollen jetzt beide kooperieren, weil sich dadurch der höchste Gewinn erzielen lässt. Die regulative Institution in Form der Sanktion hat als gestaltbare Handlungsrahmen gegriffen, ohne die Handlungsstruktur selbst verändert zu haben. Die Einhaltung der regulativen Institution erfolgt hier also durch das Verfolgen der Eigennutzmaximierung. Damit ist die Moral nach Homann systematisch in die Rahmenbedingung verlagert worden und die Akteure können dem eigenen Vorteil folgen und verfolgen dadurch über die regulative Institution das moralisch Richtige – die Kooperation. Damit ist geklärt, wie sich der Akteur verhalten soll: eigennutzmaximierend. Damit ist das erste Problem der Moral geklärt. Die Durchsetzungsproblematik der Moral ist ebenso geklärt, denn wenn es sich um eigennutzmaximierende Akteure handelt, können sie gar nicht anders als genauso zu handeln. Beide Probleme der Moral sind beseitigt und es lässt sich daraus ein ökonomischer Imperativ ableiten: Verfolge die Eigennutzmaximierung und halte dabei die Regeln ein! Als Nebensatz wäre noch zu erwähnen: Keine Sorge, die Regeln sind so gestaltet, dass die Einhaltung den größten Vorteil für dich ergibt (Homo-oeconomicus-Test). Diese Lösung geht – wie bereits erwähnt – auf Hobbes zurück (vgl. Bayertz 2006, 154). Aber es kommen Zweifel auf, ob damit tatsächlich die zwei Kernfragen der Moral gelöst sind. Dies wird nun in einer Analyse des Programms von Homann untersucht.
3 Analyse und Kritik der ökonomischen Ethik
In der Analyse und Kritik werden den Argumenten der neoklassischen Ökonomik und Ethik lebensweltliche Argumente gegenübergestellt. Dies beginnt mit der Gegenüberstellung von wertfreier Ökonomik und normativer Ökonomie (3.1), führt weiter zur Prämisse des Abspracheverbots der Spieltheorie versus der Moral als soziales Phänomen (3.2), geht auf das Eigennutzkalkül des Homo oeconomicus im Gegensatz zu den menschlichen Handlungstypen ein (3.3), um abschließend das spieltheoretische Dilemma versus lebensweltliches Polylemma zu diskutieren (3.4).
3.1 Wertfreie Ökonomik versus normative Ökonomie
Die bereits dargestellte Definition von Ökonomik, die als Grundlage dient, lautet: „Die Ökonomik befasst sich mit Möglichkeiten und Problemen der gesellschaftlichen Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil.“ (Homann/Suchanek 2005, 4) Es geht hier nicht um Knappheit, wie dies bei den meisten Wirtschaftsdefinitionen vorzufinden ist, sondern um den gegenseitigen Vorteil. Homann geht von einer Wachstumsgesellschaft aus. Das Paradigma des Wachstums wird heute nicht mehr von allen Ökonominnen und Ökonomen geteilt. Postwachstumsgesellschaft oder Postwachstumsökonomie werden heute diskutiert (einen Überblick geben z.B. Postwachstumsoekonomie 2019 oder Exploring Economics 2016). Knappheit ist als Problem ‚wegdefiniert‘.
Die Definition hebt auf die „Wissenschaft von der Wirtschaft“ (Homann/Suchanek 2005, 2) und nicht auf die Lebenswelt und Phänomenologie der Ökonomie ab. Es geht also um das Modell und die Theorie. Das in der Idee Homo oeconomicus verwirklichte Rationalitätsprinzip, das eigentlich ein zum eigenen Vorteil ausgerichtetes Zweckrationalitätsprinzip ist, versteht Homann als „eine Heuristik [Hervorhebung im Original], die die Vielfalt der Erscheinungen der sozialen Welt auf die vielfältigen Bedingungen zuschreibt und gerade dadurch viel über diese Welt, über diese Bedingungen, in Erfahrung bringt“ (Homann/Suchanek 2005, 379). Die ökonomische Ethik begründet sich auf einem – vermeintlich wertfreien – komplexitätsreduzierten, wissenschaftlichen, neoklassischen Modell. In der Ökonomik kann selbstverständlich ein solches Modell gebaut werden, aber kann bzw. soll daraus eine Handlungsanleitung für die lebensweltliche Moral abgeleitet werden? Dies ist problematisch, weil zwischen der theoretischen Welt der Ökonomik und der phänomenologischen Ökonomie wesentliche Unterschiede bestehen, wie ja Homann selbst ausführt: „Da alle Theoriebildung eine hochselektive Reduktion von Komplexität vornehmen muss, um leistungsfähig zu sein, kann sie niemals einfach phänomenologisch zugreifen.“ (Homann/Suchanek 2005, 380) Wird dieser Unterschied zwischen Ökonomie und Ökonomie unter dem Gesichtspunkt der Wertfreiheit ernst genommen (vgl. Tafner 2016), dann wird es mit aus dem Modell abgeleiteten normativen Setzungen für die lebensweltliche Ökonomie schwierig bis unmöglich. Es müssen Analogie-Schlüsse vorgenommen werden, diese sind jedoch nie zwingend schlüssig. „Die Analogieargumente können im Allgemeinen die Wahrheit ihrer Konklusion nicht garantieren, denn es besteht die […] prekäre zirkuläre Abhängigkeit zwischen der Konklusion eines solchen Arguments und dem Wahrheitsnachweis für die entscheidende Analogieprämisse. […] Die Wahrheit der Konklusion bleibt unsicher.“ (Tetens 2010, 180) Dennoch sind Analogieschlüsse lebensweltlich und wissenschaftlich beliebt, weil sie „das noch Unvertraute und Unverstandene mit dem uns schon Vertrauten und Verstandenen erklären und damit ein tief sitzendes kognitives Bedürfnis des Menschen befriedigen“ (Tetens 2010, 181). Mit dem Analogieschluss bzw. mit der Übertragung der Erkenntnisse aus der Ökonomik hinein in die lebensweltliche Wirtschaft wird die Wertfreiheit verlassen und in die Welt der Normativität eingetaucht: Es „ergibt sich als grundlegende Handlungsempfehlung, dass sich alle Akteure systemkonform verhalten sollen. Diese Empfehlung lässt sich in zwei Teile aufspalten: (1) Akteure sollen die Rahmenordnung beachten und (2) innerhalb dieser Spielregeln ihren Nutzen maximieren.“ (Homann/Lütge 2005, 58)
In der lebensweltlichen Ökonomie ist Wirtschaften immer normativ (vgl. Tafner 2018a; 2019; Ulrich 2005, 7). Es gibt implizit normative Elemente, die durch die Prämissen und die Wahl der Methoden entstehen (vgl. Rosenberger/Koller 2009, 29f.). Durch die Wahl des Gefangenendilemmas als Ausgangspunkt aller ökonomischen Überlegungen wird eine klare Setzung vorgenommen und das Denken in eine ganz bestimmte Richtung gelenkt. So hat Homann seinen Vortrag bei der DGfE mit dem Gefangenendilemma begonnen und die Prämissen und Methoden als bekannt und akzeptiert vorausgesetzt. Er ging also davon aus, dass diese Setzungen allen bekannt sind und von allen als legitim zur Erklärung aller ökonomischen Probleme akzeptiert wird. In diesem Sinne ist die Nicht-Normativität des Wertfreien selbst normativ.
Des Weiteren dienen die Erkenntnisse, die aus den Theorien und Modellen abgeleitet werden, als Handlungsanleitung für die Praxis. „Hier halten ÖkonomInnen die Einsicht nicht durch, dass die Ökonomie streng genommen keine Wirklichkeit abbildet, sondern ‚bloß‘ Modelle konstruiert.“ (Rosenberger/Koller 2009, 29) Homann versteht das Modell als eine normative Vorgabe, wenn die Regeln, die für alle gelten, auch eingehalten werden: „Die moralische Qualität der Marktwirtschaft liegt somit nicht in den Motiven der Akteure, sondern in den moralisch erwünschten Ergebnissen. […] Die moralische Qualität der modernen Marktwirtschaft hängt systematisch von der Gestaltung der Rahmenordnung ab. Wer die Moral der modernen Welt an den unmittelbar handlungsleitenden Motiven der Akteure im Wettbewerb festmachen will, sucht an der falschen Adresse und kommt folglich auch zu falschen Diagnosen (z.B. Profitgier) und zu falschen Therapievorschlägen (z.B. Umkehr). Damit hat die Marktwirtschaft als Ganze eine ethische Begründung, eine moralische, eine sittliche Qualität. Sie liegt darin, dass die Marktwirtschaft das beste bisher bekannte Mittel zur Verwirklichung der Solidarität aller Menschen darstellt. Daraus folgt, dass sich die Akteure in der Marktwirtschaft, wenn es ihnen um ethische Ziele geht, gemäß den Imperativen dieser Marktwirtschaft verhalten sollen“ (Homann 2012, 217). Hier werden die unterschiedlichen Ebenen von Ökonomie und Ökonomik vermischt (vgl. Tafner 2016). Ausgehend von der Wertfreiheit wird ein marktwirtschaftliches Modell entworfen.[2] Diese neoklassische Modellwelt wird bei Homann mit der lebensweltlichen Marktwirtschaft gleichgesetzt. Es wird also lebensweltlich argumentiert, denn das Argument oben lautet, dass es sich bei der Marktwirtschaft um das beste Mittel für Solidarität handle. Es ist keine Aussage basierend auf die neoklassische Modellwelt, denn Solidarität ist keine Kategorie innerhalb des neoklassischen Modells. Diese Aussage selbst ist lebensweltlich und als solche zu hinterfragen. Einerseits hat der Wohlstand enorm zugenommen. Das gilt nicht nur für marktwirtschaftlich organisierte Staaten, sondern auch in sozialen Marktwirtschaften und kommunistischen Systemen mit marktwirtschaftlichen Zügen. Dennoch leben noch immer hunderte Millionen Menschen in Elend und ärmlichsten Verhältnissen mit Hunger und Krankheiten. Dazu kommen globale Phänomene wie Klimawandel, Ressourcenknappheit und mangelnder Zugang zu den vorhandenen Errungenschaften (vgl. Raworth 2018, 13f.). Andererseits sind lebensweltliche Marktwirtschaften immer in Kultur und Gesellschaft eingebettet und daher keine perfekten Märkte, wie sie in der Neoklassik skizziert werden. Neben diesen empirischen Einwänden geht es ebenso um den Begriff der Solidarität, den Homann gebraucht: Böckenförde (2003, 8) definiert Solidarität als „eine Art des Einstehens füreinander“. Eine aus Solidarität erbrachte Leistung ist „eine Leistung für eine Gegenleistung, von der er aber noch nicht weiß, ob sie je fällig sein wird“ (Höffe 2010, 285). Solidarität bezieht sich darauf, dass „das gesellschaftliche Ganze und seine Glieder […] aufs engste schicksalhaft miteinander verbunden“ sind (Nell-Breuning 1985, 54). Einzelwohl und Gemeinwohl sind interdependent. Die Individuen sind für das Ganze ebenso verantwortlich, wie das Ganze für das Individuum (vgl. Nell-Breuning 1985, 54f.). Solidarität ist „nicht einfach ein Geschäft auf Gegenseitigkeit“, sondern sie „beruht auf der Anerkennung von Gemeinsamkeit“ (Callies 2004, 8). Marktwirtschaft hingegen beruht auf Leistung gegen Gegenleistung. Das ist nicht Solidarität, sondern Geschäft gegen Gegengeschäft bzw. Leistung gegen Gegenleistung. Homanns Handlungsempfehlung zielt auf den eigenen Vorteil. So verstehen Homann/Suchanek (2005, 63f.) lebensweltlich Sozialpolitik als eine „Sozialpolitik für den Markt“, welche sie als Versicherung auffassen „und streng ökonomisch im Tauschparadigma“ begründen und als „produktive Investition“ bezeichnen (Homann/Suchanek 2005, 64f.). Da ist das Wort Solidarität zu hinterfragen, vor allem vor dem Hintergrund jener, die sich – verschuldet oder unverschuldet – Leistungen nicht leisten können, weil ihnen Geld, Macht, Einfluss oder Informationen einfach nicht verfügbar sind. Hier ist es viel mehr eine solidarische Aufgabe, für diese Menschen Bedarfsgerechtigkeit zu erlangen. Genau das aber vermag instrumentelles marktwirtschaftliches Denken eben nicht – und eine Moral auf Grundlage der Eigennutzmaximierung wird dafür kein Verständnis aufbringen können. Samuelson und Nordhaus (2001, 162) führen aus, dass ein freier Markt, wenn er in Realität so funktionieren würde, wie in der neoklassischen Theorie beschrieben, nur für Effizienz sorgen könnte, aber nicht für Gerechtigkeit. Das sei eben eine politische Frage, die ökonomisch nicht gelöst werden könne. Auf die Problematik der Ungerechtigkeit angesprochen, antwortete Homann in der Diskussion nach seinem Vortrag bei der DGfE ebenso in diesem Sinne und führte aus, dass Ungerechtigkeiten der Staat ausgleichen müsse. Der Staat aber lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht schaffen kann (Böckenförde-Theorem, Böckenförde 1967, 93). Wenn wir nicht solidarisch denken und leben, wird der Staat nicht für Solidarität sorgen können. Solidarität ist keine Dimension in der neoklassischen Ökonomik und systemkonform handelnde Menschen werden kein Verständnis für Solidarität aufbringen.
Die Wertfreiheit wird auch an folgender Stelle durchbrochen: „Wirtschafts- und Unternehmensethik hat sich [Hervorhebung Autor] von Moralisieren, Appellieren, Postulieren – und deren negativen Pendants wie Schuldzuweisungen, moralischer Entrüstung etc. – tunlichst und peinlichst [Hervorhebung durch den Autor] fernzuhalten.“ (Homann/Blome-Drees 1992, 18f.) Diese Formulierung, die vor dem Normativen warnt, ist selbst normativ verfasst. Homann geht aber noch ein Stück weiter, wenn in einem Ethik-Lehrbuch für Studierenden ausgeführt wird: „In diesem Buch treiben wir normative Ethik. Wir nehmen Stellung zur Marktwirtschaft und erwarten, dass diese wertende Stellungnahme von anderen geteilt wird.“ (Homann/Lütge 2005, 13) Normativer könnte nicht formuliert werden.
3.2 Abspracheverbot in der Spieltheorie versus soziales Phänomen Moral
Eine wesentliche Prämisse der Spieltheorie in Dilemma-Situationen ist die Annahme, dass es keinerlei Absprachen gibt. Das bedeutet auch, dass es keine Moral als soziales Phänomen im Modell gibt, denn Moral ist eine sozial konstruierte Absprache und Regel, also eine Institution. Regulative Institutionen (Gesetze) wirken mit rechtlichen Sanktionen, normative Institutionen (Moral) über äußeren sozialen Druck und in Form von Gewissensbissen als innerer Druck. Am stärksten wirken sogenannte kulturell-kognitive Institutionen, also normative und/oder regulative Institutionen, die zu Selbstverständlichkeiten geworden sind. Wir halten diese Regeln grundsätzlich deshalb ein, weil sie selbstverständlich sind und nicht, weil sie sanktioniert werden. Institutionen wirken also durch Sanktionen, aber auch deshalb, weil deren Einhaltung selbstverständlich ist (vgl. Scott 2001). Selbstverständlichkeit bedeutet nicht, dass diese Institutionen immer eingehalten werden! Institutionen determinieren nicht, sondern sind Leitlinien des Handelns. Durch Erziehung, Sozialisation und Enkulturation sind wir in Gesellschaft und Kultur eingebettet und lernen moralisch richtiges Handeln, meist implizit durch Nachahmung. Moral in diesem Sinne beschreibt, was der Mensch tun und was er unterlassen soll. So hat jeder Mensch eine grundsätzliche Vorstellung davon, was moralisch richtig oder falsch ist. Bemerkenswert ist, dass die wesentlichen moralischen Grundwerte in allen Weltreligionen vertreten werden: nicht töten, nicht lügen, nicht stehlen, nicht betrügen und nicht ehebrechen (wie immer auch Ehe definiert ist). Diese Form der Moral ist eine Minimalmoral, sie kann als die Moral im engeren Sinne definiert werden. Sie hat die Aufgabe, sowohl den Einzelnen vor der Gruppe als auch die Gruppe vor dem Einzelnen zu schützen. Moral im weiteren Sinne beschreibt „einen Komplex von Normen, Werten oder Idealen, der jedem Individuum einen allgemeinen Leitfaden für die Gestaltung seines Lebens bereitstellt“ (Bayertz 2006, 34). Die Moral im weiteren Sinn zielt auf das gelungene Leben, welches keine Selbstverständlichkeit darstellt. Dieses gute Leben ist nur im Zusammenleben mit anderen Menschen möglich. In der Moderne steht die Moral im engeren Sinn im Mittelpunkt, u.a. auch deswegen, weil die Frage nach dem eigenen Lebensstil heute plural gelebt wird (vgl. Bayertz 2006, 34f.).
Mit Homanns Zugang scheinen die zwei wesentlichen Fragen der Moral gelöst zu sein. Beim moralischen Handeln geht es um zwei Kernprobleme, nämlich erstens das moralisch richtige Handeln zu identifizieren und zweitens, dass als richtig erkannte moralische Handeln auch tatsächlich zu tun (vgl. Bayertz 2006, 18). Die Ethik als das philosophische Hinterfragen der Moral, bietet für das erste Problem unterschiedliche Zugänge an. Die ökonomische Ethik orientiert sich bei der Entscheidung des richtigen Handelns an der zweckrationalen Eigennutzorientierung und folgt damit dem eigenen Vorteil bei gleichzeitiger Einhaltung der Rahmenordnung. Mit der Eigennutzmaximierung als Handlungsanleitung wird nach Homann auch gleichzeitig das zweite und schwierigste Problem der Ethik vermeintlich gelöst: das Durchsetzungsproblem (vgl. Niemann 2011, 17): „Die Hauptidee ist, dass sich im Marktgeschehen das Eigeninteresse, auch wenn es sich zu Egoismus und Habgier steigert, mit ‚geeigneten Rahmenbedingungen‘ immer in Bahnen lenken lässt, die insgesamt zu einer Verbesserung unseres Lebens führen, speziell was den Wohlstand und die Versorgung mit Gütern, Dienstleistungen und Informationen anbelangt.“ Damit hätte Homann den Stein der Weisen gefunden, was bislang keinen Philosophen gelungen ist. Es ist wohl gleich zu Beginn Zweifel angebracht, dass eine Ethik, die auf Egoismus gründet, auf festem Grund baut (vgl. Niemann 2011, 17).
Dass der Mensch nicht immer das tut, was moralisch bzw. ethisch geboten ist, liegt in der Natur des Menschen. Bereits im Mittelalter wurde in der Scholastik über diese Frage diskutiert. Thomas von Aquin ging davon aus, dass der Mensch zum Guten neige. Dem widersprach Wilhelm von Ockham und argumentierte, dass der Mensch die Freiheit der Willkür habe, also selbst entscheiden könne, ob er das Gute wolle oder nicht. Das ist der entscheidende Punkt: Der Mensch kann das moralisch Gute erkennen, aber sich dennoch anders entscheiden (vgl. Pinckaers 2004, ff.). Neben dieser bewussten Entscheidung sind es aber auch Gedankenlosigkeit, Willensschwäche oder Bequemlichkeit, die zur Nichteinhaltung der Moral führen. Darüber hinaus gibt es sechs Begründungen für die zweite Kernfrage (vgl. Bayertz 2006, 20f.): 1) Aus Naivität können Menschen, vor allem Kinder, fragen, warum sie eigentlich moralisch handeln sollen. 2) Aus Protest können Menschen, vor allem Jugendliche, bewusst gegen das moralisch Richtige handeln, um sich abzugrenzen. 3) Die Angst vor der Ausbeutung kann dazu führen, auch dann nicht moralisch zu handeln, wenn das Moralische erkannt worden ist. Ein solches Verhalten kann beobachtet werden, wenn Menschen die Erfahrung gemacht haben, dass sie selbst der oder die Dumme sind, wenn sie moralisch handeln. Warum sollen sie selbst moralisch handeln, wenn andere das nicht tun? 4) Skeptizismus tritt dann zutage, wenn die rationale Erkennbarkeit der richtigen Moral überhaupt bezweifelt wird. Aber es ist einsichtig, dass nicht jede Form der Moral bezweifelt werden kann. Es gibt moralisches Handeln, das leicht verständlich ist. Der totale Skeptizismus ist daher mehr ein theoretischer Standpunkt als gelebte Praxis. 5) Der amoralische Eigennutzmaximierer folgt konsequent seinen eigenen Interessen. Das moralische Richtige kann erkannt werden, die Umsetzung jedoch hängt vom eigenen Vorteil ab. Moralisch gehandelt wird nur dann, wenn es nützt. Er verhält sich der Moral gegenüber opportunistisch: Nützt die Moral, wird sie eingehalten, nützt sie nicht, wird sie nicht eingehalten. Es handelt sich um einen Egoisten. 6) Der Immoralist sieht in der Moral überhaupt etwas Sinnloses oder Verkehrtes und steht der Moral daher aus Prinzip negativ gegenüber. Es geht darum, unmoralisch sein zu wollen, jemanden bewusst schaden zu wollen, also boshaft zu sein. Er benötigt die Moral als eine normative Vorgabe, denn er möchte genau das Gegenteil tun. Er verfolgt die Handlung also gerade deshalb, weil sie unmoralisch ist.
Die ökonomische Ethik reduziert in ihren spieltheoretischen Grundlagen die Frage, warum Moral eigentlich eingehalten werden sollte, letztlich auf zwei Typen: den amoralischen Eigennutzmaximierer und den Akteur, der Angst vor der Ausbeutung hat und sich deshalb eigennutzmaximierend verhält. Beide sprach Homann in seinem Vortrag auch konkret an. Damit werden nicht nur die anderen vier Typen, sondern auch jene ausgegrenzt, welche die Frage, warum sie überhaupt moralisch sein sollen, gar nicht stellen. Lebensweltlich stellt dies eine starke Reduktion der Bedeutung von Moral dar. Moral ist, um es nochmals zu betonen, eine soziale Realität und Institution, wie dies auch Adam Smith in Theory of Moral Sentiments darlegt. Der Selbstliebe und dem Selbstinteresse des Menschen wird durch seine Fähigkeit zur Sympathie – heute sagen wir Empathie –, sein Gewissen (unparteiische Beobachter) und die Moral Schranken gesetzt. Der Mensch ist bei Adam Smith gerade eben kein Eigennutzmaximierer und Egoist, der um jeden Preis, seine Interessen durchsetzen will (vgl. Eckstein in Smith 1977, XXIVff.; Euchner in Mandeville 2012, 35; Kurz/Sturn 2013, 31; Tafner 2018b, 79ff.). Überdies sagt die Durchsetzbarkeit einer Moral, welche Homann durch das Verfolgen des Eigennutzes zu garantieren glaubt, noch nichts über ihren ethischen Anspruch aus. Nur weil eine Moral durchsetzbar ist, ist sie noch lange nicht ethisch. So ist Gaunermoral oder Ehrenmord durchsetzbar. Deshalb sind sie noch nicht ethisch legitimiertes moralisches Verhalten. Über die Richtigkeit der Moral kann die Ökonomik keine Auskunft geben, das bleibt Aufgabe der Ethik, die eben keine ökonomische Ethik ist (vgl. Aßländer/Nutzinger 2010, 235).
Aber es geht noch einen wesentlichen Schritt weiter: Ohne Moral ist Wirtschaften gar nicht möglich. So wie der Staat von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht schaffen kann (Böckenförde-Theorem, vgl. Böckenförde 1967, 93), lebt auch die Wirtschaft von Voraussetzungen, die sie selbst nicht schaffen kann (Neuhold 2009, 25). Nida-Rümelin (2011, 59ff.) zeigt dies am Beispiel des Kommunizierens: Ohne Kommunikation gäbe es kein Management. Eine wesentliche Voraussetzung für Kommunikation sind Verlässlichkeit, Vertrauen und Wahrhaftigkeit. Kommunikation funktioniert nur, wenn die Teilnehmenden an der Kommunikation davon ausgehen, dass sie wahrhaftig sind. Könnten wir nicht grundsätzlich davon ausgehen, dass wir in der Kommunikation wahrhaftig sind, würde keine Kommunikation stattfinden, weil sie sinnlos wäre. Es wird also grundsätzlich davon ausgegangen, dass wir wahrhaftig miteinander kommunizieren. Nun kann sich ein Mensch einen eigenen Vorteil dadurch holen, indem er lügt. Die Lüge wiederum funktioniert nur deshalb, weil grundsätzlich davon ausgegangen wird, dass wahrhaftig kommuniziert wird. Der Lügner ist also ein Parasit. Er kann nur deshalb lügen, weil die anderen davon ausgehen, dass er wahrhaftig kommuniziert. Der Lügner bedarf der Moral der anderen. Würden aber alle unwahrhaftig sein wollen, dann würde die Kommunikation zusammenbrechen, weil niemand mehr den anderen trauen könnte. Eine Vorteilsmaximierung durch Lügen ist also nur deshalb möglich, weil die anderen sich moralisch verhalten. Würden alle ihren eigenen Vorteil durch die Lüge maximieren, würde die Kommunikation zusammenbrechen. Eine einzelne Person kann oder einige wenige können sich einen Vorteil verschaffen, wird diese Maximierung aber zur Leitvorstellung für alle, dann bricht die Kommunikation zum Schaden aller zusammen. Die Summe aller Eigennutzmaximierungen ist damit nicht der größte Nutzen aller. „Auf der Verwechslung von kollektiv Alle und distributiv Alle verbirgt sich die vielleicht wirkungsmächtigste Ideologie der Gegenwart. Das kollektive Interesse aller ist nicht identisch mit dem distributiven Interesse aller.“ (Nida-Rümelin 2011, 74) Nida-Rümelin gibt ein konkretes wirtschaftliches Beispiel dazu: Als die Finanzkrise ihren Höhepunkt erreichte, kam es zu einer Kreditklemme, weil die Banken sich untereinander kein Geld mehr borgten und dadurch der Geldmarkt versagte. Die Zentralbank musste einspringen. Der Zusammenbruch war die Folge des Misstrauens: Keine Bank vertraute mehr der Kommunikation der anderen: Waren die Zahlen der Bilanz wahrhaftig (vgl. Nida-Rümelin 2011, 66f.)?
Zusammengefasst: Wer Absprachen im Modell nicht zulässt, grenzt damit individuelle und soziale Absprachen und damit auch die Moral als ein soziales Phänomen aus. So gibt es im spieltheoretischen Dilemma keine sozial konstruierte Moral, keine Vorstellung von Reue, also den Willen zum Eingestehen seiner eigenen Fehler. Es gibt keine Gaunerehre, sodass die Gauner schweigen, weil sie einer eigenen – ethisch zwar zu verwerfenden Moral, aber dennoch vorhandenen Moral – folgen. Gaunerehre kann es in diesem Modell gar nicht geben, obwohl empirisch ein solches Verhalten gerade innerhalb von kriminellen Organisationen, wie z.B. die Mafia, zu beobachten ist. Wie überhaupt das Gefangenenmodell in Bezug auf die Gesellschaft schräg liegt. Wenn die beiden Kriminellen kooperieren, defektieren sie gegen die Gesellschaft. Aus gesellschaftlicher Sicht ist eigentlich die Defektion erwünscht, denn die Gesellschaft möchte Tätern habhaft werden, damit sie ihre Strafe erhalten. Die Kooperation der Gauner verunmöglicht die Sanktionen, verunmöglicht damit die Zusammenarbeit der Gemeinschaft, die ein solches Verhalten bestraft haben möchte. Daraus ist zu lernen, dass Kooperation per se moralisch weder gut noch schlecht ist, denn es stellt sich immer die Frage, wer kooperiert unter welchen Bedingungen mit wem. Gesellschaftlich wollen wir nicht jede Kooperation, auch wenn sie individuell erwünscht wird. Auch hier gilt: „Das kollektive Interesse aller ist nicht identisch mit dem distributiven Interesse aller.“ (Nida-Rümelin 2011, 74) So wird einsichtig, dass Gemeinwohl nicht einfach die Summe aller Einzelinteressen ist. Die Neoklassik unterstellt implizit, dass die Summe aller Eigennutzkalküle tatsächlich zum größten gemeinsamen Nutzen führen soll. Meist implizit wird in der neoklassischen Theorie dem Theorem der harmonia praestabilita gefolgt: „Der größte überhaupt mögliche Nutzen springt unbedingt zuverlässig und ganz von selbst dann heraus, wenn alle einzelnen ihr wohlverstandenes Eigeninteresse wahren.“ (Nell-Breuning 1974, 70) Wie dies geschieht, bleit in der Neoklassik offen. Oftmals wird in diesem Zusammenhang auf die Metapher unsichtbare Hand von Adam Smith verwiesen, die sowohl in Wealth of Nations als auch in Theory of Moral Sentiments je nur ein einziges Mal vorkommt. „Keine ist so gründlich missverstanden und irreführend verwendet worden.“ (Kurz/Sturn 2013, 79)
3.3 Eigennutzkalkül des Homo oeconomicus versus Handeln des Menschen
Die Wirtschaftswissenschaft – auch Homann – „arbeitet mit der methodischen Reduktion eines mechanistischen Weltbildes“ (Rosenberger/Koller 2009, 27), indem methodisch auf das zweckrationale Handeln reduziert wird (siehe Fußnote 2). Die Verhaltensökonomik hat in vielen Experimenten das Konstrukt des Homo oeconomicus für die Lebenswelt verworfen (einen guten Überblick geben Sigmund, Fehr und Nowak 2002, 52ff.). Homann und Suchanek (2005, 383) sehen das jedoch anders: „Für eine Widerlegungen des Homo-oeconomicus-Konstrukts reichen solche ‚Befunde‘ nicht.“ Erstens sei die Verhaltensökonomik mit ihren Experimenten nicht realitätsnäher. Zweitens werde der Homo oeconomicus als Menschenbild angegriffen, was er gar nicht sei. Drittens gehe es um einen Vorteilsbegriff, der sich nicht nur auf das Monetäre, sondern auch auf nicht-materielle Vorteile beziehe, wie z.B. intrinsische Belohnung oder soziale Anerkennung (vgl. Homann/Suchanek 2005, 382f.). Über die Relativität der Realitätsnähe von Verhaltensökonomik im Vergleich zur Neoklassik ließe sich trefflich streiten, das kann hier jedoch nicht geleistet werden. Dass der Homo oeconomicus bei Homann normativ Verwendung findet und dadurch zum Menschenbild wird (3.3.1) und dass der totalitäre Vorteilsbegriff nicht nur als methodischer Imperialismus Anwendung findet (3.3.2) wird nun kritisch dargelegt.
3.3.1 Homo oeconomicus als Menschenbild
Das Argument, dass die Verhaltensökonomik den Homo oeconomicus als Menschenbild missverstehe, kann so allgemein nicht gelten. Die Verhaltensökonomik ist fähig, die Unterscheidung zwischen Menschenbild und wissenschaftlichem Konstrukt grundsätzlich vorzunehmen. Jedoch ist die Unterscheidung zwischen Konstrukt und Menschenbild nicht so trivial, da Menschenbilder soziale Konstrukte sind. Soziologen weisen darauf hin, dass sich das Modell reifiziert und damit Wirklichkeit werden kann (vgl. Tafner 2015, 482ff.). Keynes (1997, 383) schreibt: „The ideas of economists and philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed the world is ruled by little else.“
Solche Argumente sind nach Homann/Lütge (2005, 76) „Fehldeutungen der Funktion, des methodologischen Status, des Homo oeconomicus“ als „Theoriekonstrukt“. Die Leistungsfähigkeit einer Einzelwissenschaft liege in der Komplexitätsreduktion, um „die Theorie auf eine hochselektive Problemstellung zu fokussieren“ (Homann/Lütge 2005, 76). „Für welches spezifische Problem stellt dieses Konstrukt die ‚Lösung‘ in dem Sinne dar, dass es erklärt, warum die Dinge so laufen, wie sie laufen. Gesucht ist also das Problem, auf das der Homo oeconomicus die adäquate – oder zumindest eine plausible – Antwort darstellt. Unsere Antwort: Das Konstrukt Homo oeconomicus vermag die Interaktionsresultate bzw. -muster zu erklären, die in Dilemmastrukturen systematisch zu erwarten sind [alle Hervorhebungen im Original]. Der Homo oeconomicus ist damit implizit auf Dilemmastrukturen berechnet, ohne dass dies bislang explizit gemacht worden wäre. […] Wenn kooperative Vorleistungen Einzelner zu ihrer Schlechterstellung führen, wie das in Dilemmastrukturen der Fall ist, dann müssen sich alle Menschen, wollen sie ihre Interessen schützen, über kurz oder lang, u. U. nach Lernprozessen, wie ein Homo oeconomicus verhalten. In Dilemmastrukturen muss jeder auf seinen individuellen Vorteil allein achten, da ansonsten die Gefahr besteht, dass er ausgebeutet wird. Da er das weiß, muss er zur Defektionsstrategie greifen.“ (Homann/Lütge 2005, 77)
Diese Argumentation führt jedoch dazu, dass vom komplexitätsreduzierten theoretischen Konstrukt Homo oeconomicus, das in der Neoklassik als Prämisse Verwendung findet, zu einem Menschenbild übergeleitet wird. Das wertfreie Konstrukt Homo eoconomicus ist bei Homann die Lösung des Dilemmaproblems. Argumentativ verbirgt sich hier entweder eine deskriptiv nicht schlüssige Konklusion oder eine normative Setzung. Dies zeigt die Darstellung in Form von Argumenten:
Wenn im Dilemma von der dominanten Strategie unter der Annahme des Verbots von Absprachen und in der Prämisse von einem zweckrationalen Eigennutzmaximierer ausgegangen wird, dann liegt die Lösung des Problems mit den Prämissen bereits auf dem Tisch. Wer diese Prämissen akzeptiert, hat die Konklusion ebenso akzeptiert. Die Argumentation aufbauend auf zwei Prämissen führt zur Konklusion a:
P1: Der Homo oeconomicus ist ein Konstrukt, das sich eigennutzmaximierend verhält.
P2: Eigennutzmaximierendes Verhalten ist die Lösung des Dilemmas.
Ka: Das Verhalten des Homo oeconomicus ist die Lösung des Dilemmas.
Nachdem Menschen (!) sich nach Homann – wie oben ausgeführt – systemkonform verhalten sollen, ist der Homo oeconomicus doch ein Menschenbild und damit mehr als ein theoretisches Konstrukt. Es ist eine normative Setzung (siehe 3.1). Die Argumentation wird also fortgesetzt, allerdings als nicht zwingende Konklusion oder als eine versteckt (!) normative:
P3: Das Verhalten des Homo oeconomicus ist die Lösung des Dilemmas.
P4: Ein Mensch befindet sich in einem Dilemma.
Kb: Der Mensch soll sich wie Homo oeconomicus verhalten.
Ka ist deskriptiv schlüssig: Wer P1 und P2 für wahr hält und rational schlüssig denkt, muss auch Ka akzeptieren. Kb verhält sich anders. Kb ergibt sich nicht zwingend aus P3 und P4. Kb ist, wie Homann ja auch ausführt, eine Handlungsempfehlung. Damit ist es ein normatives Argument. Ein normatives Argument benötigt zumindest eine normative Prämisse, da es sich ansonsten um einen naturalistischen Fehlschluss handelt. Da P4 eine deskriptive Prämisse ist, muss P3 eine normative Setzung sein. An diesem Punkt gibt es nur zwei Möglichkeiten: entweder es ist P3 eine normative Setzung und Kb eine normative Konklusion oder P3 ist eine deskriptive Aussage und das Argument deskriptiv nicht schlüssig. Da es sich nach Homann um eine Handlungsempfehlung handelt, ist P3 eine normative Setzung. Damit ist Homann widersprochen: Der Homo oeconomicus ist als Handlungsempfehlung eine normative Setzung und damit ein Menschenbild (zu normativen Argumenten vgl. Tetens 2010, 140ff.).
3.3.2 Der totalitäre Vorteilsbegriff
Der totalitäre Vorteilsbegriff zielt auf zwei unterschiedliche, aber eng miteinander verknüpfte Problemlagen: Es geht um den zweckrationalen Eigennutzen und um einen ökonomischen Imperialismus. Zuerst wird der zweckrationale Eigennutzen erörtert, danach der ökonomische Imperialismus.
3.3.2.1 Zweckrationale Eigennutzmaximierung
Im Modell handelt der Homo oeconomicus ausschließlich zweckrational (es geht also darum, ob P1 überhaupt zugestimmt wird). Max Weber (1984, 44ff.) führt aus, dass der Mensch idealtypisch vier Handlungstypen folgt und reine Zweckrationalität eher selten ist. „Zweckrational handelt, wer sein Handeln nach Zweck, Mittel und Nebenfolgen orientiert und dabei sowohl die Mittel gegen die Zwecke, wie die Zwecke gegen die Nebenfolgen, wie endlich auch die verschiedenen möglichen Zwecke gegeneinander rational abwägt: also jedenfalls weder affektuell […] noch traditionell handelt.“ (Weber 1984, 45) Neben der Zweckrationalität gibt es also ebenso affektuelles und traditionelles Handeln. Als ebenso rationales Handeln bezeichnet er wertrationales Handeln: „Rein wertrational handelt, wer ohne Rücksicht auf die vorauszusehenden Folgen handelt im Dienst seiner Überzeugung von dem was Pflicht, Würde, Schönheit, religiöse Weisung, Pietät, oder die Wichtigkeit einer ‚Sache‘ gleichviel welcher Art, ihm zu gebieten schein.“ (Weber 1984, 45) Mit Sigmund Freud (2016) wissen wir, dass der Mensch auch Unbewusstes tut. Im Neo-Institutionalismus wird darauf aufmerksam gemacht, dass Akteure – Menschen und Organisationen – in ökonomischen und außer-ökonomischen Handeln nicht so zweckrational handeln können, wie sie einerseits in Modell beschrieben werden und andererseits lebensweltlich nach außen vorgeben: „Anders als für Weber […] sind […] Legitimitäts- und Effizienzerfordernisse nicht deckungsgleich. Im Gegenteil, Organisationen entwickeln formal-rationale Strukturen zur Erzielung von Legitimität und nicht zur möglichst effizienten Problembearbeitung. Die provokante These lautet, dass formale Organisationsstrukturen Mythen zum Ausdruck bringen, die in ihrer gesellschaftlichen Umwelt institutionalisiert sind.“ (Hasse/Krücken 2005, 22f.) Ist bei Max Weber (1984, 46) „absolute Zweckrationalität des Handelns […] nur ein im Wesentlichen konstruktiver Grenzfall“, so ist zweckrationales Handeln im Neo-Institutionalismus ein Mythos, um unser Handel, das unterschiedlich begründet sein kann oder überhaupt ein nicht bewusstes Tun darstellt, zweckrational zu legitimieren.
Homann/Suchanek (2005, 382) gehen von einem umfassenden Vorteilsbegriff aus: „Für uns ist der Vorteilsbegriff, der das Handeln leitet, im Anschluss an G. S. Becker systematisch offen und umfasst daher nicht-materielle Vorteile, sogenannte ‚intrinsische‘ Belohnungen und soziale Anerkennung, ebenso wie materielle oder monetäre Vorteile.“ Ebenso ist der Nutzen völlig offen: „Der Begriff ‚Nutzen‘ ist in der modernen Ökonomik völlig offen und keineswegs nur monetär zu verstehen.“ Homann/Suchanek (2005, 27) zählen dazu die Umsatzmaximierung eines Unternehmens, Maximierung des monetären Einkommens, die Wiederwahl eines Politikers, die Einschaltquoten eines Showmasters, die eigene persönliche Identität, „ja sogar das Wohlergehen anderer Menschen kann Bestandteil ‚meines Nutzens‘ sein, wenn ich mich altruistisch verhalte. […] Der Ansatz des methodologischen Individualismus […] geht lediglich davon aus, das Individuen es sind, die ‚handeln‘, und dass sie im Handeln ihrem jeweiligen Nutzen zu mehren trachten.“ Sedláček (2009) begreift den Nutzen als ein leeres Konstrukt, denn alles, was der Mensch tue, werde dem Nutzen unterworfen. Jedes Handeln wird mit dem Nutzen erklärt. Was ist dann eigentlich nicht Nutzen? „Wenn jemand seinen Nutzen (den jeder selbst definiert) maximiert, würde Popper sofort fragen: Wie würde er den handeln müssen, um seinen Nutzen nicht zu maximieren? Anders ausgedrückt: Können wir in eine Richtung gehen, die unserer Optimierungsfunktion entgegengesetzt ist? Falls es nicht möglich ist, ein entsprechendes Beispiel anzuführen, ist die Theorie nicht falsifizierbar und de facto sinnlos.“ (Sedláček 2009, 283) Aßländer und Nutzinger (2010, 244 in Bezug auf Berger 2007, 39) kritisieren ebenso Homanns Nutzenbegriff, der „jedes moralische Verhalten und jede Verhaltensweise, sofern es eine Alternative zu ihr gibt, ex post als Ausfluss individueller Nutzen- und Vorteilsüberlegung deuten lässt, jedoch um den Preis, dass die Aussagekraft derartiger Hypothesen trivial wird“.
Wenn ein derart weit gefasster Vorteils- und Nutzenbegriff verwendet wird, wirft dies also philosophische Probleme auf: Sedláček (2009, 283) wirft eine erkenntnistheoretische Frage auf und Aßländer/Nutzinger verweisen auf die Trivialität, ex post alles als Nutzen darzustellen. Ergänzt sollen zwei weitere Problematiken werden:
Erstens zeigt sich spieltheoretisch ein wesentlicher Unterschied, ob jemand seinen eigenen Nutzen verfolgt oder altruistisch handelt. Altruismus führt zur Kooperation, welche keiner Sanktion bedarf, und Eigennutz jedoch zur Defektion, welche Sanktionen bedarf. Wird also Altruismus und Kooperation als Nutzen bezeichnet, ist unklar, ob überhaupt Sanktionen gesetzt werden sollen. Das ganze Programm Homanns ist in Frage gestellt, wenn Eigennutzmaximierung sowohl Kooperation als auch Defektion bedeutet.
Zweitens kann der Mensch aus unterschiedlichen Gründen zum eigenen Vorteil handeln. Er kann selbstinteressiert oder egoistisch handeln. Das ist aber nicht dasselbe: „Selbstinteresse heißt der Beweggrund eines Menschen, dem es in allem Tun und Lassen letztlich nur um sich selbst geht. […] Das Selbstinteresse (Eigennutz) ist das natürliche Motiv des Menschen. […] Unsittlich ist es allerdings, das Selbstinteresse zum letzten Maßstab allen Handelns zu machen und es ohne Rücksicht auf die Interessen und Rechte der Mitmenschen zu verfolgen (Egoismus).“ (Höffe 2008, 273f.) Er kann aber auch boshaft oder altruistisch handeln. Wenn auch dies als Handeln zum eigenen Vorteil bezeichnet wird, dann sind Boshaftigkeit, Egoismus, Selbstinteresse und Altruismus Gründe eigennutzbringende Handlungsweisen. Mit dem Verfolgen des eigenen Vorteils ist also neoklassisch – vor allem moralisch gesehen – noch nicht viel gesagt.
3.3.2.2 Ökonomischer Imperialismus versus ökonomischer Aspekt
Homann (2005, 201) legt Wert darauf, dass seine „Argumentationen über weite Strecken ökonomistisch“ sind, es sich aber um einen „methodischen Ökonomismus handelt“, was die Kritik „trotz expliziter Auskunft meinerseits“ ignoriere. Trotz der expliziten Auskunft handelt es sich um Ökonomismus nicht nur im methodischen Sinn, denn Homann spricht lebensweltliche Bereiche an. „Dies reicht weit über den ‚Bereich der Wirtschaft‘ hinaus und findet z.B. statt auch bei Fragen des Heiratens und generativen Verhaltens, der Diskriminierung, der Kriminalität und des Drogenkonsums, aber auch in Bereichen wie Politik und Bürokratie und dergleichen mehr.“ (Homann/Suchanek 2005, 5) Dieser „ökonomische Imperialismus“ habe „nichts mit wissenschaftlichen Omnipotenzansprüchen zu tun“, sondern sei nicht mit Gegenstandsbereichen, „sondern von der Problemstellung her zu bestimmen“ (Homann/Suchanek 2005, 386f.) Nun könne man grundsätzlich jede Handlung auch unter dem ökonomischen Aspekt untersuchen (vgl. Ulrich 2005). Aber Homann möchte letztlich eine ökonomische Leitorientierung. „Die Aufklärung mit den Konzepten Dilemmastrukturen und Homo oeconomicus bewahrt Akteure vor ‚naiver‘, ‚blinder‘ Kooperation, die nach unseren Ausführungen nur zu folgenschweren Enttäuschungen führt und interaktionistisch nicht stabil sein kann, weil sie nicht reflexionsresistent ist.“ (Homann/Suchanek 2005, 399) Das ist wiederum eine klare normative Setzung, die alle anderen nicht-neoklassischen Zugänge als „naiv“ und „blind“ zurückweist.
Peter Ulrich (2005) macht darauf aufmerksam, dass jede Handlung unter dem ökonomischen Aspekt betrachtet werden könne, dies aber nicht normativ missverstanden werden dürfe. Aspekt bedeutet ja, dass es sich um einen Teil des Ganzen handelt. Wer das Ganze verstehen will, sollte auch den ökonomischen Aspekt betrachten. Wer aber nur den ökonomischen Aspekt betrachtet, versteht die Zusammenhänge nicht. Und wer dies auch noch normativ missversteht, interpretiert die Welt ökonomistisch.
Homann nennt das Beispiel Heiraten. Eine Heirat kann auch unter einem ökonomischen Aspekt betrachtet werden: Wer übernimmt die Ausgaben, wer erzielt die Einnahmen? Wie werden die gemeinsamen Kinder materiell versorgt? Wer wird erben? Das sind alles Fragen, die auch von ökonomischer Bedeutung sind. Wer jedoch das Heiraten nur ökonomisch versteht oder aus ökonomischer Leitperspektive betrachtet, hat den Sinn des Heiratens nicht verstanden und soll besser nicht heiraten. Menschliches Handeln kann immer auch unter dem ökonomischen Aspekt gesehen werden. Wenn wir aber alles nur noch aus dem ökonomischen, neoklassischen Kalkül betrachten, wird unsere Gesellschaft ökonomistisch, dann wird die Gesellschaft in die Wirtschaft eingebettet und nicht wie es sein sollte, die Wirtschaft in die Gesellschaft.
3.3.2.3 Monetäre Effizienz versus reale Effizienz
Eigennutzmaximierung bedeutet im betriebswirtschaftlichen Kontext Gewinnmaximierung. Aber auch hier gilt: „Das kollektive Interesse aller ist nicht identisch mit dem distributiven Interesse aller.“ (Nida-Rümelin 2011, 74) Tichy (2009, S. 6ff.) führt am Beispiel der SUVs aus, dass Rebound-Effekte dazu führen, dass die Preise für Ressourcen sinken, dafür aber größere Autos gebaut werden, die mehr Kraftstoff verschwenden, größere Parklücken und breitere Straßen benötigen. Um 80 Kilogramm in einer Stadt von A nach B zu transportieren, werden Allrad-Autos – wie oft gibt es in Städten die Notwendigkeit dafür? – mit bis zu zwei Tonnen Eigengewicht verwendet. Diese Autos werfen hohe Gewinne ab. Die monetäre Effizienz im Sinne der Gewinnmaximierung ist erreicht. Monetäre Effizienz entspricht jedoch nicht der realen Effizienz: Gewinnmaximierung bedeutet nicht notwendigerweise Ressourcenschonung (ich verdanke diesen Hinweis Kollegin Heidrun Leonhardt, Universität für Bodenkultur Wien)! Luhmann (1988, 179) hat in der Knappheit eine ähnliche Paradoxie erkannt: „Der Zugriff erzeugt mithin Knappheit, während zugleich Knappheit als Motiv für den Zugriff fungiert. […] Knappheit ist demnach, wenn man nicht von der einzelnen Operation, sondern vom System ausgeht, in dem sie stattfindet, ein paradoxes Problem. Der Zugriff schafft das, was er beseitigen will. Er will sich eine zureichende Menge sichern und schafft dadurch die Knappheit, die es erst sinnvoll macht, sich eine unzureichende Menge zu sichern.“
Wirtschaftspädagogisch ist ein instrumentelles ökonomisches Denken und Handeln, das die Gewinn- und Nutzenmaximierung in den Mittelpunkt stellt, zu hinterfragen. Einer der bedeutendsten Vertreter der katholischen Soziallehre bringt dies so auf den Punkt: „Erhebt man, wie namentlich die Schulbücher der BWL es zu tun lieben, einen ‚Kapitalismus‘ dieser Art zum System mit der Gewinnmaximierung als Axiom, dann verabsolutiert man das in sich selbst eines Maßes entbehrende und daher zu Übersteigerung ins Maßlose neigende abstrakte Erwerbstreben zum Prinzip. Ein solches ‚System‘ wäre unmenschlich. […] Unglücklicherweise übt aber das Lehrbuchmodell einen erzieherisch äußerst verderblichen Einfluss aus: das Denken des angehenden Wirtschaftsbeflissenen wird in eine gefährliche Richtung gelenkt, indem aller angeblichen oder vorgeschützten Wertfreiheit zum Trotz die Gewinnmaximierung normativ zum Sinn der Wirtschaft erhoben und zugleich als Lohn für strenge Befolgung des pleonastisch so genannten ökonomischen Rationalprinzips hingestellt wird.“ (Nell-Breuning 1973, 38f.)
3.4 Spieltheoretische Dilemma versus lebensweltliche Polylemma
Bofinger (2015, 31) schreibt kritisch über die Spieltheorie: „Problematisch wird es erst, wenn manche Ökonomen Landkarten von Regionen entwickeln, die nur noch in ihren Köpfen existieren und dabei den Anspruch erheben, eine Orientierungshilfe für die reale Welt zu bieten. Leider sind solche ‚Spiel-Theorien‘ in den letzten Jahren stark in Mode gekommen.“
Homann fokussiert die Dilemma-Situation und will damit alle ökonomischen Problemstellungen beantworten. Lassen sich tatsächlich alle ökonomischen Fragestellungen auf ein Dilemma reduzieren? Nein. Wirtschaftliche Fragestellungen sind komplex und interdependent. Sie sind vielmehr Polylemma. Eine solche Komplexität geht weit über eine einfache Matrix hinaus. Lebensweltlich kommen zur mehrfachen Vernetzung der Probleme und zum ökonomischen Aspekt auch der soziale, politische und ethisch-moralische dazu. Diese weiteren Aspekte werden aber aus der Spieltheorie ausgeblendet. Wird die soziale, moralische und kulturelle Dimension mitberücksichtigt, so sieht bereits eine einfache Dilemma-Situation völlig anders aus, wie das nachfolgende Beispiel zeigt (Tafner 2015, 404ff.):
Eine bekannte Geschichte erzählt, dass ein armes Brautpaar zur Hochzeit einlud. Die Hochzeitsgäste wurden gebeten, Wein mitzunehmen, weil sich das Paar Wein für alle nicht leisten konnte. Alle Gäste schütteten bei der Ankunft ihre mitgebrachten Flüssigkeiten in ein großes Fass. Als im Laufe des Festes auf das Paar angestoßen wurde, erkannten alle, dass nicht Wein, sondern nur Wasser gereicht wurde. Die Gäste brachten Wasser und nicht Wein, die Kooperation scheiterte. In einer Entscheidungsmatrix mit zwei Gästen sieht das wie in Tabelle 5 dargestellt aus (ein solches Beispiel kann nach Ansicht Homanns durchaus verwendet werden, weil sich ökonomisches Denken auf alle Bereiche des Lebens ausdehnen lässt):
Tabelle 5: Entscheidungsmatrix im Hochzeitsbeispiel (Kooperation und Defektion)
|
Gast A |
|||
|
Wein einfüllen |
Wasser einfüllen |
||
|
Gast B |
Wein einfüllen |
1/1 |
1/0 |
|
Wasser einfüllen |
0/1 |
0/0 |
|
Kooperieren die Gäste (1 steht für Wein, 0 für Wasser), dann ergibt sich der größte Gewinn, denn es wird reiner Wein getrunken. Kooperiert nur einer, so ist der Wein verwässert. Defektieren beide, gibt es nur Wasser. Die Darstellung als Dilemma zeigt hier die Grenzen: Werden tatsächlich nur zwei Personen eingeladen, dann werden wohl beide nur Wein mitbringen, weil die Defektion auf jeden Fall erkennbar wäre. Die Peinlichkeit möchte man sich einfach ersparen. Es geht also um ein moralisches Gefühl. Kommen viele, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, nicht als Defektierer erkannt zu werden. Folgt man der dominanten Strategie, dann würden alle Teilnehmenden Wasser mitbringen. Lebensweltlich erscheint dies beinahe absurd: Wer zur Hochzeit eingeladen wird, wird im Normalfall alles tun, um die Wünsche des Hochzeitspaars zu entsprechen. Das gebietet der Anstand. Nun könnte Homann einwenden, dass der Altruismus der eigene Nutzen wäre. Aber auch das ist absurd, denn das Ergebnis in der Matrix ist bei Altruismus etwas völlig anderes als im Verfolgen des Eigennutzens: Im ersten Fall wird reiner Wein eingeschenkt, im zweiten Fall nur Wasser. Altruismus und Egoismus zeitigen völlig unterschiedliches Verhalten. Der Unterschied zwischen Altruismus (Kooperation) und Egoismus (Defektion) – beides im Sinne Homanns Nutzen – kann auch am Beispiel der Bauern durchgespielt werden. Auch dort zeigen sich völlig konträre Ergebnisse.
Zurückkommend auf das Beispiel mit den beiden Bauern, wird darüber hinaus klar, dass eine kleine Veränderung das Ergebnis im Dilemma völlig verändert: Wird davon ausgegangen, dass sich die Bauern jedes Jahr zur Ernte treffen, werden sie viel leichter in Vorleistung treten, weil sie ja beide wollen, dass ihnen im kommenden Jahr geholfen wird (vgl. Roth 2018, 34ff.). Axelrod (1984, 19f.) wollte wissen, was passiert, wenn die Dilemma-Situation iterativ gespielt wird. Er lud zu einem Programmierwettbewerb ein, welchen Anatol Rapoport mit der Strategie tit-for-tat (Wie du mir, so ich dir) als das einfachste Programm gewann. Die Strategie beginnt kooperierend. Kooperiert der Mitspielende, so wird die Kooperation aufrecht gehalten. Defektiert der Mitspielende, so wird ebenfalls defektiert. Nach einer gewissen Zeit wird wieder versucht, Kooperation anzubieten. Einfache Grundregeln für die Kooperation könnten daher sein: Sei kooperativ. Sei aber nicht blöd, wenn das Vertrauen gebrochen wird. Zeige, dass das nicht toleriert wird und breche die Kooperation ab. Sei aber verzeihend, sodass du wieder zur Kooperation einlädst und wieder einen Vertrauensvorschuss leistest. Sei berechenbar, sodass dein Gegenüber dich besser einschätzen kann (vgl. Axelrod 1984, 19ff.; Sprenger 2007, 169ff; Roth 2018, 34ff.; Tafner 2015, 377ff.). Ebenso treffen sich die Hochzeitsgäste in unterschiedlichen Kontexten wieder. Was aber nicht bedeutet, dass sie alle nur deshalb kooperieren. Der Anstand, eine Bitte, ein Versprechen oder ein freundschaftliches Verhältnis können für sich bereits gute Gründe für das Handeln sein.
4 Fazit: Ein fair gespieltes Spiel ist ein faires Spiel
In Kapitel 2 wurden Prämissen und Aussagen der ökonomischen Ethik kritisch analysiert. Es haben sich einige Schwachpunkte des Konzeptes in Bezug auf die Wertfreiheit, die Moral als soziales Phänomen, das Nutzenkalkül und den Homo oeconomicus sowie den ökonomischen Imperialismus und der spieltheoretischen Dilemma-Situation gezeigt.
Die größte Schwachstelle jedoch liegt in einer Grundannahme selbst, die mehrfach angesprochen wurde: Die Idee, dass der systematische Ort der Moral die Rahmenordnung sei. Das greift zu kurz, denn ohne Individualethik ist keine Institutionenethik zu haben. Vielmehr ist die Individualethik für den Erfolg der Institutionenethik entscheidend.
Homann (2012, 177) versucht seine Institutionenethik anhand des Fußballspiels darzulegen: „Ein Vergleich mit dem Sport macht die Grundidee am einfachsten klar: Die Fairness wird durch die Spielregeln garantiert, über deren Einhaltung der Schiedsrichter wacht; erst auf dieser Grundlage kann es mit dem Anpfiff in den Spielzügen Wettbewerb geben, mit dem Ziel, durch innovative, kreative Spielzüge den Gegner zu besiegen.“ Das ist eine aus drei Gründen bemerkenswerte Metapher.
Erstens wird deutlich, dass es selbst unter fairen Bedingungen einen Gewinner und einen Verlierer gibt – es sei denn, das Spiel geht unentschieden aus. Es ist aber keinesfalls so, dass es zwei Gewinner gibt. Das Spiel führt also nicht zum Vorteil beider. Beide wollen gewinnen, aber nur einer kann gewinnen. Da helfen alle regulativen Institutionen nichts. Fußball ist Wettbewerb. Da gibt es Gewinner und Verlierer. Man könnte meinen, die Fans sind immer die Gewinner. Nein, auch dort wird es Gewinner und Verlierer geben, abhängig davon, welcher Mannschaft die Fans anhängen. Fußball ist also kein Unternehmen zum gegenseitigen Vorteil aller.
Um diese Metapher wiederum ins Lebensweltliche zu übertragen, ist ein Analogieschluss notwendig, der nicht zwingend schlüssig ist. Dennoch: In jedem Wettbewerb – auch in der Wirtschaft – gibt es Gewinner und Verlierer. Es ist keine Veranstaltung zum Vorteil aller. Es ist so einfach nicht, dass immer die gewinnen, die von jedem Konsumenten und jeder Konsumentin als die besten Anbieter geschätzt werden. Alle können nie gewinnen, immer wird es Verlierer auch geben.
Zweitens überwacht – so Homann – der Schiedsrichter die Einhaltung der Spielregeln. Fußballspieler wissen, dass der Schiedsrichter nicht alles sieht und auch nicht sehen kann. Er kann also kein faires Spiel garantieren. Aber als Foul gilt dennoch nur das, was der Schiedsrichter als Foul ausweist. Schiedsrichterentscheidungen sind Tatsachenentscheidungen. Seine Entscheidung gilt, egal ob er sich irrt oder nicht. So kann eine Entscheidung gerecht oder ungerecht sein. Die Entscheidung des Schiedsrichters garantiert also keine Fairness (vgl. Deckenbrock 2018).
Drittens der wesentlichste Punkt überhaupt: Homann schreibt, dass die Regeln für Fairness sorgen. Die Regeln selbst bewirken nichts. Sie sind für sich genommen Makulatur. Es sind die Spielenden, welche die Regeln einhalten oder nicht. Es sind die Spielerinnen und Spieler, die spielen. Von ihnen hängt die Fairness ab. Anders gesagt: Ein faires Spiel ist ein fair gespieltes Spiel. Hinge sie nur von den Regeln ab, dann wäre jedes Spiel unter gleichen Regeln gleich fair. Das aber ist gerade nicht der Fall. Es hängt einfach von den Spielerinnen und Spielern ab. Es kommt also auf ihr moralisches Verhalten an. Und dieses Verhalten wiederum hängt nicht nur von den Sanktionen ab, denn diese sind ja unter den gleichen Regeln dieselben. Entscheidend ist die Einstellung dem fairen Spiel gegenüber. Es geht letztlich um die Individualethik. Homann (2012, 217) sieht das anders: „Es ist das System der Spielregeln, die Organisation oder Ordnung der Wirtschaft, die die zahllosen eigeninteressierten Handlungen der Akteure in jene Richtung kanalisiert, die allgemein erwünscht ist.“
Damit komme ich zum selben Schluss wie Aßländer und Nutzinger (2010), 227: „Unsere Kritik an Karl Homanns wirtschaftsethischer Position richtet sich also auf den in unseren Augen bewusst heruntergesetzten Stellenwert individueller Moral, die in seiner Wirtschaftsethikkonzeption keinerlei systematische [Hervorhebung im Original] Bedeutung mehr besitzt.“
Homann (2012, 217) sieht den Bezug auf die Regeln in Adam Smiths Werk begründet: „Die Antwort stammt wiederum von A. Smith: Es ist das System der Spielregeln, die Organisation oder Ordnung der Wirtschaft, die die zahllosen eigeninteressierten Handlungen der Akteure in jene Richtung kanalisiert, die allgemein erwünscht ist.“ Obwohl auf Smith Bezug genommen wird, stützt sich das nicht auf die Philosophie von Adam Smith (Aßländer/Nutzinger 2010, 240; Tafner 2018b, 79f.): Nochmals komme ich auf Adam Smiths Werk Theory of Moral Sentiments zurück. Dort wendet er sich gegen eine Moral des Egoismus (selfish-system), die in seiner Zeit um sich griff (vgl. Eckstein in Smith 1977, XXIV–XXV; Euchner in Mandeville 2012, 35, Kurz/Sturn 2013, 31): „Das Glück eines anderen zerstören, nur weil es unserem eigenen im Wege steht, ihm zu nehmen, was ihm wirklich nützlich ist, nur weil es für uns ebenso nützlich oder noch nützlicher sein kann, das wird kein unparteiischer Zuschauer gutheißen können – er wird es so wenig gutheißen können, wie jede andere Handlung, bei der sich der Mensch jenem natürlichen Hange hingibt, sein eigenes Glück dem Glück aller anderen vorzuziehen und auf deren Kosten zu befriedigen.“ (Smith 1977, 124) Jeder Mensch hat in sich einen unparteiischen Zuschauer, der die eigene Person und andere beobachtet. Er macht uns auf eigenes und fremdes unmoralisches Handeln aufmerksam und beschränkt unser Handeln. Wir hören aber nicht immer auf ihn. Es gibt deshalb einen zweiten Schranken, der das Selbstinteresse des Menschen beschränkt. Die Moral führt zu sozialen Druck von außen. Wenn weder der unparteiische Beobachter noch die Moral greifen, dann sind es die Gesetze, die ihre Wirkung entfalten. Homann erwähnt im Kontext von Smith weder die Sympathie, noch den unparteiischen Beobachter, noch die Moral, sondern hebt gleich auf die Bedeutung des Gesetzes ab. Damit findet aber die Bedeutung der Individualethik, die bei Adam Smith eine wesentliche Rolle spielt, keine Berücksichtigung. Angesprochen auf diese Verkürzung in seinen Arbeiten und die zu geringe Beachtung der Individualethik, gab mir Homann in der Diskussion im Anschluss an seinem Vortrag Recht und führte aus, dass er der Individualethik mehr Raum hätte geben können. Das ist ein wichtiger Punkt, aber er ist m.E. nicht hinreichend, weil ohne Individualethik die Institutionenethik gar nicht funktioniert. Moral benötigt beides! Scharf kritisiert Bayertz (2006, 154) die Verkürzung der Moral auf die Sanktionsmöglichkeit der regulativen Institutionen in Bezug auf Hobbes: „Nur Phantasten können übersehen, dass die weitgehende Einhaltung von Rechtsnormen […] dem Staat und seinen Sanktionsandrohungen zu danken ist. Es ist sicher nicht allein Ausdruck lauterer moralischer Gesinnung […]. Gleichwohl aber greift die Hobbessche Lösung zu kurz. Schon im Hinblick auf Rechtsnormen muss bezweifelt werden, dass sie allein durch äußeren Zwang aufrechterhalten werden können. Ohne ein Minimum an Ehrlichkeit und Anstand wäre ein gigantischer Überwachungs- und Verfolgungsapparat erforderlich, um die Rechtstreue der Bürger zu erzwingen.“
Wesentlich für die ökonomische Bildung und Erziehung ist die Trennung von Ökonomie und Ökonomik (vgl. Tafner 2016, 2018a, 2019). Zur wissenschaftlichen Komplexitätsreduktion im Modell ist es legitim, Vereinfachungen vorzunehmen. Drei Prämissen sind dabei für die Wirtschaftspädagogik jedoch problematisch (vgl. Tafner, erscheint 2019):
1) Nur eigennutzmaximierendes Handeln ist Wirtschaften.
2) Nur eigennutzmaximierendes Handeln soll Wirtschaften sein.
3) Jedes menschliche Handeln ist und soll wirtschaftliches Handeln sein.
Wesentlich ist die Erkenntnis, dass wirtschaftliche Erziehung oder Bildung, welche einen pädagogisch-didaktischen Anspruch stellen will und auch auf die Lebenswelt abzielt, niemals eine ausschließlich instrumentell ökonomische sein kann, sondern immer um das Soziale, Ethische und Politische zu ergänzen ist. Damit ist jede ökonomische Erziehung oder Bildung zugleich auch eine sozioökonomische. Ethische Grundlage ist dabei eine Individual- und Institutionenethik.
Literatur
Aßländer, M./Nutzinger, H. G. (2010): Der systematische Ort der Moral ist die Ethik! Einige kritische Anmerkungen zur ökonomischen Ethik Karl Homanns. In: Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik (zfwu), 11(3), 226-248.
Axelrod, R. (1984): The evolution of cooperation. New York.
Bayertz, K. (2006): Warum überhaupt moralisch sein? München.
Berger, J. (2007): Vorteilshandeln und moralisches Handeln: Ein Kommentar zu Karl Homann. In: Streck, W./Beckert, J. (Hrsg.): Moralische Voraussetzungen und Grenzen wirtschaftlichen Handelns, MPlfG Working Paper. Mack-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung. Köln, 37-42.
Böckenförde, E.-W. (1967). Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation. In: Forsthoff, E. (Hrsg.): Säkularisation und Utopie. Ernst Forsthoff zum 65. Geburtstag. Stuttgart, 75-95.
Böckenförde, E.-W. (2003): Grundlagen europäischer Solidarität. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.06.2003, 8.
Bofinger, P. (2015): Grundzüge der Volkswirtschaftslehre. Eine Einführung in die Wissenschaft von Märkten. 4. aktual. Aufl. Hallbergmoos.
Callies, C. (2004): Globalisierung der Wirtschaft und Internationalisierung des Staates – Subsidiaritätsprinzip und Solidaritätsprinzip als Strukturprinzipien der Kompetenzverflechtung zwischen Staaten und Internationalen Organisationen. In: Institut für Völkerrecht der Universität Göttingen, Abteilung Europarecht – Göttinger Online-Beiträge zum Europarecht (1), 1-17.
Deckenbrock, C. (2018): Fehlentscheidungen von Schiedsrichtern. Deutscher Anwaltstag 2018. In: Anwaltsblatt. Das Fachmagazin für Anwältinnen und Anwälte. Online: https://anwaltsblatt.anwaltverein.de/de/anwaeltinnen-anwaelte/vereinsarbeit/fehlentscheidungen-von-schiedsrichtern (24.04.2019).
Exploring Economics (2016): Ökologische Ökonomik. Online: https://www.exploring-economics.org/de/orientieren/oekologische-oekonomik/ (24.04.2019).
Freud, S. (2016): Das Unbewusste. Stuttgart.
Gutenberg, E. (1957/2002): Betriebswirtschaftslehre als Wissenschaft. Akademische Festrede gehalten bei der Universitätsgründungsfeier am 22. Mai 1957, Krefeld. In: Brockhoff, K. (Hrsg.): Geschichte der Betriebswirtschaftslehre. Kommentierte Meilensteine und Originaltexte. 2. Aufl. Wiesbaden, 9-28.
Hasse, R./Krücken, G. (2005): Neo-Institutionalismus. 2. Aufl. Bielefeld.
Höffe, O. (2008): Lexikon der Ethik. 7. neubearb. und erw. Aufl. München.
Höffe, O. (2010): Gerechtigkeit. Eine philosophische Einführung. 4. Aufl. München.
Homann, K. (2003): Grundlagen einer Ethik der Globalisierung. In: Hentschel, B. (Hrsg.): Zwischen Profit und Moral. Für eine menschliche Wirtschaft. München, 35-72.
Homann, K. (2005): Wirtschaftsethik: Versuch einer Bilanz und Forschungsaufgaben. In: Beschorner, T./Hollstein, B. (Hrsg.): Wirtschafts- und Unternehmensethik. Rückblick, Ausblick, Perspektiven. München, 197-211.
Homann, K. (2012): Ethik der Marktwirtschaft. In: May, H. (Hrsg.): Lexikon der ökonomischen Bildung. 8. Aufl. München, 216-218.
Homann, K./Blome-Drees, F. (1992): Wirtschafts- und Unternehmensethik. Göttingen.
Homann, K./Lütge, C. (2002): Vorteile und Anreize. Zur Grundlegung einer Ethik der Zukunft. Tübingen.
Homann, K./Lütge, C. (2005): Einführung in die Wirtschaftsethik. 2. Aufl. Münster.
Homann, K./Suchanek, A. (2005): Ökonomik. Eine Einführung. Tübingen.
Hume, D. (1978): A Treatise of Human Nature. Deutsche Übersetzung von Theodor Lipps: Ein Traktat über die menschliche Natur. Band 2. Hamburg.
Keynes, J. M. (1997): The general theory of employment, interest, and money. New York.
Kurz, H. D./Sturn, R. (2013): Die größten Ökonomen: Adam Smith. Konstanz, München.
Luhmann, N. (1998): Die Wirtschaft der Gesellschaft. Frankfurt a. M.
Mandeville, B. (2012): Die Bienenfabel. Mit einer Einleitung von Walter Euchner. Frankfurt a. M.
Mankiw, N. G. (2001): Principles of economics. 2. Aufl. Fort Worth.
May, H. (Hrsg.) (2012): Lexikon der ökonomischen Bildung. 8. Aufl. München.
Nell-Breuning, O. (1974): Kapitalismus – kritisch betrachtet. Zur Auseinandersetzung um das bessere ‚System‘. Freiburg.
Nell-Breuning, O. (1985): Gerechtigkeit und Freiheit. Grundzüge katholischer Soziallehre. 2. Aufl. München.
Neuhold, L. (2009): Momente der Krise und die katholische Soziallehre. Aufforderung zum Tieferblicken anlässlich des Erscheinens von „Caritas in veritate“. In: Poier, K. (Hrsg.): Wirtschaftskrise und Katholische Soziallehre. 30 Jahre Neugründung des Dr.-Karl-Kummer-Instituts in der Steiermark. Graz.
Nida-Rümelin, J. (2011): Die Optimierungsfalle. Philosophie einer humanen Ökonomie. München.
Niemann, H.-J. (2011): Die Nutzenmaximierer. Der aufhaltsame Aufstieg des Vorteilsdenkens. Tübingen.
Ötsch, W. O. (2019): Mythos Markt. Mythos Neoklassik. Das Elend des Markfundamentalismus. Marburg.
Pies, I. (2010): Karl Homanns Programm einer ökonomischen Ethik. ‚A View from Inside‘ in zehn Thesen. In: Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik, 11(3), 249-261.
Pinckaers, S. (2004): Christus und das Glück. Grundriss der christlichen Ethik. Göttingen.
Postwachstumsoekonomie (2019): Website. Online: http://www.postwachstumsoekonomie.de/material/grundzuege/ (24.04.2019).
Raworth, K. (2018): Die Donut-Ökonomie. Endlich ein Wirtschaftsmodell, das den Planeten nicht zerstört. München.
Rosenberger, M./Koller, E. (2009): Problemstellungen, Methoden und Konzepte der Unternehmensethik. In: Feldbauer-Durstmüller, B./Pernsteiner, H. (Hrsg.): Betriebswirtschaftslehre und Unternehmensethik. Wien, 23-48.
Roth, M. (2018): Nichts als Illusion? Zur Realität der Moral. Stuttgart.
Samuelson, P. A./Nordhaus, W. D. (2001): Economics. 17. Aufl. Boston.
Scott, W. R. (2001): Institutions and organizations. 2. Aufl. Thousand Oaks, California.
Sedláček, T. (2009): Die Ökonomie von Gut und Böse. Darmstadt.
Sigmund, K./Fehr, E./Nowak, M. A. (2002): Teilen und Helfen – Ursprünge sozialen Verhal-tens. In: Spektrum der Wissenschaft, März 2002, 52-59.
Smith, A. (1977): Theorie der ethischen Gefühle. Übersetzung von Walther Eckstein. 2. Aufl. Hamburg.
Sprenger, R. K. (2007): Vertrauen führt: Worauf es im Unternehmen wirklich ankommt. Frankfurt a. M.
Tafner, G. (2015): Reflexive Wirtschaftspädagogik. Wirtschaftliche Erziehung im ökonomisierten Europa. Eine neo-institutionelle Dekonstruktion des individuellen und kollektiven Selbstinteresses. Humboldt-Universität zu Berlin: Habilitationsschrift. Detmold.
Tafner, G. (2016a): Die Trennung von Ökonomie und Ökonomik als die Crux der ökonomischen Bildung. In: Arndt, H. (Hrsg.): Das Theorie-Praxis-Verhältnis in der ökonomischen Bildung. Herausgegeben im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für ökonomische Bildung. Schwalbach/Ts., 30-42.
Tafner, G. (2018a): Ökonomische Bildung ist sozioökonomische Bildung. Grundlagen der Didaktik einer reflexiven Wirtschaftspädagogik. In: Engartner, T./Fridrich, C./Graupe, S./ Hedtke, R./Tafner, G. (Hrsg.): Sozioökonomische Bildung und Wissenschaft. Entwicklungslinien und Perspektiven. Wiesbaden, 109-140.
Tafner, G. (2018b): „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.“ (Mt 4,4) Sinn und Verantwortung als lebensdienliche Brücken von Wirtschaft und Religion. Zeitschrift für Didaktik der Gesellschaftswissenschaften (zdg), Religion, H. 2, 68-86.
Tafner, G. (2019): Das Sozioökonomische und das Kaufmännische. Einbettung von Organisationen in Gesellschaft und Kultur als Ausgangspunkt des Einbezugs in die sozioökonomische Bildung. In: Fridrich, C./Hedtke, R./Tafner, G. (Hrsg.): Historizität und Sozialität in der sozioökonomischen Bildung. Wiesbaden, 49-80.
Tafner, G. (erscheint 2019): Ökonomische Bildung in einer ökonomisierten Gesellschaft. Oder: Welche Bildung benötigen Bürgerinnen und Bürger im wirtschaftlichen Kontext? In: Goldschmied, N./Keipke, Y./Lenger, A. (Hrsg.): Ökonomische Bildung als Gesellschaftstheorie: Ökonomische Kompetenz, wirtschaftliches Verstehen und reflexives Urteil. Heidelberg.
Tetens, H. (2010): Philosophisches Argumentieren. Eine Einführung. 3. Aufl. München.
Tichy, G. (2009). Nachhaltiges Wachstum? Zum Thema dieses Hefts. In: Wissenschaft & Umwelt interdisziplinär, 13, 4-9.
Ulrich, P. (2005): Sozialökonomische Bildung für mündige Wirtschaftsbürger. Ein programmatischer Entwurf für die gesellschaftliche Rekontextualisierung der wirtschaftswissenschaftlichen Lehre. Universität St. Gallen: Institut für Wirtschaftsethik.
Weber, M. (1984): Soziologische Grundbegriffe. Tübingen.
Zabeck, J. (2002): Moral im Dienste betrieblicher Zwecke? Anmerkungen zu Klaus Becks Grundlegung einer kaufmännischen Moralerziehung. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 98(4), 485-503.
[1] Werte vor dem Schrägstrich stehen für B und Werte hinter dem Schrägstrich für A. Bei der Darstellung der Alternativen der Kriminellen wird meist von schweigen (kooperieren) gesprochen. Treffender ist leugnen.
[2] Die neoklassische Modellwelt abstrahiert in vier Schritten: Es werden erstens alle sozialen Phänomene auf messbare reduziert. Es folgt die zweite Reduktion auf einen autonom gedachten Wirtschaftsbereich mit eigenen Regeln, welcher ohne Institutionen, Kultur, Macht und sozialen Beziehungen auskommt. Die dritte Reduktion engt die Wirtschaft auf Märkte ein. Gesprochen wird von Marktwirtschat, damit verschwindet z.B. was innerhalb von Unternehmen geschieht oder außerhalb von Märkten. Die vierte Reduktion reduziert die Märkte auf den vollkommenen Markt (vgl. Ötsch 2019, 199ff.) Diese vierfache Reduktion hat Folgen: „Das Modell der vollkommenen Konkurrenz zeigt damit, wie ein spezifischer Markt funktioniert, und gleichzeitig, wie die Wirtschaft insgesamt funktioniert, weil das Modell der vollkommenen Konkurrenz der Prototyp für jeden Markt ist. ‚Der Markt meint (und das wird in den Lehrbüchern regelmäßig auf nicht gesagte Weise vermengt) einen bestimmten Markt und zugleich die ganze Wirtschaft […]: Teil und Ganzes sind miteinander vermischt.“ (Ötsch 2019, 213)
Zitieren des Beitrags
Tafner, G. (2019): Eigennutzmaximierung als Richtschnur moralischen Handelns? Antithesen zu Homanns ökonomischer Wirtschaftsethik. In: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Ausgabe 35, 1-28. Online: http://www.bwpat.de/ausgabe35/tafner2_bwpat35.pdf (15.05.2019).

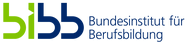












Diesen Beitrag kommentieren
Die Kommentare werden erst nach einer Prüfung durch bwp@ veröffentlicht.
Wider das Primat der Oekonomie
Dankenswerterwe ise macht Georg Tafner in nachdrücklicher Weise deutlich, dass die neoliberale Ideologie ein in sich nicht logisches Konstrukt ist, aber ungeachtet dessen in massiver Weise Deutungsmacht beansprucht. Der Beitrag ist damit ein guter Ausgangspunkt für eine Diskussion der Prämissen einer Wirtschaftspädagogik und darüber hinausgehend der kaum in Frage gestellten Grundüberzeugung en zur Bildungsökonomie (und damit zur Organisationsen twicklung von Schule) - diese wären ggf. ein eigenes Themenheft wert, zumal wenn es gelänge, den angelegten Bezug zu moralischen und ethischen Fragen zu verdeutlichen.Ein Schritt
Tafners Beitrag ist ein willkommener Anstoß zu einer Diskussion um die Normativität in der BWP einerseits und zur Auseinandersetz ung mit einem Nützlichkeit sprimaten andererseits. Seine plausible Kritik lenkt den Blick auch auf das von ihm vertretene Konzept der Reflexiven Wirtschaftspädagogik und regt die Hoffnung an, hier die zu seinen Antithesen passenden Auflösungen zu finden. Dieser Enthusiasmus wird nach der Lektüre der Ausführungen im bwp@ Spezial 14 gedämpft. Tafners Argumentation entkommt selbst nicht konsequent dem Primaten der ökonomische n Verwertbarkeit des Individuums durch die Berufsbildung. Die Mündigkeit als pädagogische s Prinzip, an der ihm ja durchaus gelegen scheint, wird damit zweite Wahl und nur dort tragbar, wo sie Arbeitseffizien z fördert.So scheinen Antithesen zu einer Ethik, die den Menschen auf sein Wenigstes reduziert, nur ein erster Schritt zu sein um wieder das zu explizieren, was die Berufs- und Wirtschaftspädagogik als Humanität erst vermuten ließe.
(K)Eine Frage der Ethik
Es ist ja nicht das erste Mal, dass durch eine Fülle von schlüssigen Argumentationen und lebensweltliche n Verweisen aufgezeigt wird, dass in Homanns "ökonomische r Wirtschaftsethi k" in Wirklichkeit die Ökonomik alle Aufgaben einer Ethik übernommen hat. So stelle ich als Ethik-Lehrender im Masterstudium "Angewandte Ethik" immer wieder mit Verwunderung fest, welchen hohen Stellenwert Homanns Ansatz in der wirtschaftspädagogische n Debatte (immer noch) einnimmt.Georg Tafner enttarnt Homanns Ansatz nicht nur als einen "naturalistische n Fehlschluss", er macht darüber hinaus vor allem auch deutlich, dass es ohne individualethis che Aspekte zu keiner Unternehmens- und Institutionenet hik kommen kann. Darüber hinaus sollte auch immer wieder in Erinnerung gerufen werden, dass Wirtschaft im streng ökonomische n Sinn zwar immer effizient sein muss, dass jene aber immer bloß als ein "Mittelsystem" zur Selbstverwirkli chung des Menschen gedacht werden muss.