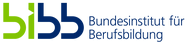Über bwp@
bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.
bwp@ Formate
F Forschungsbeiträge
D Diskussionsbeiträge
B Berichte & Reflexionen
P Aus der Praxis
bwp@ 30 - Juni 2016
Inklusion in der beruflichen Bildung
Hrsg.: , &
Inklusion an berufsbildenden Schulen in Niedersachsen: Zur regionalen Differenzierung von Zielgruppen, pädagogischen Kulturen und Handlungskonzepten
Insbesondere in der Niedersächsischen Berufsvorbereitung werden Schüler[1] mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf von jeher gemeinsam unterrichtet. Allein deswegen markieren berufsbildende Schulen den wohl einzigen schulischen Sektor mit impliziter Inklusionserfahrung. Mit dem Inklusionsprozess erwächst ihnen die Aufgabe, immer größere Anteile an Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf den ersten Arbeits- und Ausbildungsmarkt vorzubereiten. Doch diese Aufgabe erweist sich als hoch differenziert. Die Förderquoten konzentrieren sich in ungleich beschaffenen Gegenden. Dies verweist auf spezifische Zielgruppen und pädagogische Kulturen, an die die Herausforderung inklusiver Berufsbildung anschließen muss.
Der Beitrag will diesen unterschiedlichen Gegebenheiten nachgehen und auf dieser Grundlage differenzierte Anforderungen und Lösungsansätze formulieren. Dabei soll sich auf zentrale Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung des zwischen 2013 und 2015 durch den ESF und das Land Nieder-sachsen geförderten Projekts „Teilhabe und Inklusion im Übergang Schule-Beruf Modellregion Lüneburg (TIM)“ bezogen werden.
Zunächst wird auf Grundlage regionaler und überregionaler Datenanalysen eine inklusionsspezifische Gebietstypologie entwickelt. Dem werden die mit quantitativen Instrumenten erhobenen Struktur-merkmale der Zielgruppen und die Erwartungen und Erfahrungen von Lehrenden an drei exem-plarischen Schulstandorten gegenüber gestellt. Weitergehend werden auf der Grundlage narrativer Inter-views und ethnografischer Sondierungen erhobene pädagogische Kulturen und geplante Inklusions-vorhaben beschrieben. Abschließend werden auf der Grundlage ethnografischer Beobachtungen über-tragbare Handlungsempfehlungen erstellt.
[1] Die männliche Schreibweise bezieht im Meinen die weibliche ein
Inclusion in Vocational Schools in Lower Saxony: The Regional Differentiation of Target Groups, Educational Culture and Action Concepts
In Lower Saxony, the mixed class instruction of students with and without special educational needs has always been a feature of preparation courses for vocational training. For this reason alone, vocational schools are probably the only branch of education with implicit experience of inclusion. As a result of the inclusion process, they are faced with the task of preparing an ever larger share of share of students with special educational needs for the regular (unsubsidised) employment and training markets. However, this task is highly complex. There are disparities between the regions to which the quotas of students with special educational needs apply. This indicates the existence of specific target groups and educational cultures, which the challenge of inclusive vocational education must take into account.
This contribution sets out to investigate the different conditions and, based on this, to formulate differentiated requirements and solutions. It draws on the core findings of the research accompanying the project "Participation and Inclusion in the Transition from School to Work in the Model Region Lüneburg" (Teilhabe und Inklusion im Übergang Schule-Beruf Modellregion Lüneburg [TIM]), which ran from 2013 to 2015 and was funded by the ESF and the Land of Lower Saxony.
First of all, an inclusion-specific area typology is developed on the basis of regional and supraregional data analyses. This is then contrasted with the structural features of the target groups, which have been identified with quantitative instruments, and the expectations and experiences of teachers at three schools used as examples. On the basis of information obtained from narrative interviews and ethno-graphic exploration, the contribution proceeds to describe educational cultures and planned inclusion projects. Finally, transferable recommendations are made on the basis of ethnographic observations.
1 Ausgangslage: Zur besonderen Position berufsbildender Schulen im Inklusionsprozess
Wenige Begriffe fallen hinsichtlich Image und Wirklichkeit so weit auseinander, wie der der Inklusion. Gibt man in der gängigsten Internet-Suchmaschine exemplarisch die Begriffe „Inklusion“ und „Schule“ ein und betrachtet die angezeigten ersten 100 Bilder mit graphisch oder auf Fotos dargestellten Personen, so sind mehr als die Hälfte davon in Rollstühlen oder mit Gehhilfe zu sehen.[1] Unter solchen – wenngleich sehr exemplarischen – Eindrücken muss es erscheinen, als konzentriere sich der Inklusionsprozess auf Personen, die allein aufgrund in ihnen selbst liegender Beeinträchtigen bislang von sozialer (Bildungs-) Teilhabe ausgeschlossen blieben. Tatsächlich waren im Schuljahr 2013/14 aber nur 7,0vH der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf dem Schwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung zugeordnet. Weit größere Anteile entfielen auf die Förderschwerpunkte Lernen (37,7vH) und Emotionale und soziale Entwicklung (16,1vH) (eigene Berechnung anhand KMK 2016, XV). Mehrheitlich geht es hier also um Diagnosen von Einschränkungen, die optisch nicht sichtbar gemacht und nur bedingt als in den betroffenen Personen liegende Problematiken interpretiert werden können (vgl. z. B. Bojanowski 2012, 5; Herz 2013, 5).
Dies deutet bereits die Relationalität des in Deutschland institutionalisierten Behindertenbegriffs und eine dem Inklusionsprozess hinterlegte soziale Dimension an: Ohne die angewandte Diagnostik in Frage zu stellen, ist doch zu vermuten, dass sie vorrangig junge Menschen betrifft, denen solche Bedürftigkeit zu einer anderen Zeit der Geschichte nicht widerfahren wäre. Bekanntlich ist die Klassifizierungsrate sonderpädagogischen Förderbedarfs in Westdeutschland seit den frühen 1950er Jahren von rund 2vH auf etwa 5vH im Jahr 2000 gestiegen (vgl. Powell 2004, 9). Diese Entwicklung hält trotz Inklusion bis in die Gegenwart an. Zwischen 1999 und 2014 ist die gesamtdeutsche schulische Förderquote (sonderpädagogische Förderung in Förderschulen und allgemeinen Schulen zusammen) kontinuierlich von 5,1vH auf 7,0vH bei einem allerdings wachsenden Anteil an Integrationsschülern gestiegen (KMK 2010,4, 10; 2016,4, 10). Lange Zeit haben dem Zuwächse anerkannter Rehabilitanden bei der Bundesagentur (bzw. -anstalt) für Arbeit entsprochen. In den Kontexten struktureller Jugendarbeitslosigkeit und wachsender Qualifizierungsanforderungen hatte sich in Westdeutschland zwischen 1967 und 1978 die Zahl der behinderten Personen unter 18 Jahren, deren berufliche Rehabilitation abschließend behandelt wurde, mehr als versechsfacht (Bundesanstalt für Arbeit 1980, 5). In Ostdeutschland, wo bis zur Wende keine Lernbehinderungskategorie existierte und weniger stark behinderte junge Menschen generell betrieblich in Teilberufen ausgebildet wurden (Keune et al. 1996, 10.), vollzog sich in den 1990er Jahren ein vergleichbarer Nachholprozess. Hier hat sich der Bestand anerkannter Rehabilitanden zur beruflichen Ersteingliederung allein zwischen 1992 und 1995 mehr als verdoppelt[2]. Spätestens seit dem Millennium wird jedoch in ganz Deutschland ein diametraler Rückgang solcher außerschulischen Förderungen vermerkt (vgl. Wittwer/Seyd 2004, 3; Zelfel 2007 60ff.; Rauch et al. 2008; DGB 2012, 3ff.). Dies betrifft seit einigen Jahren in verstärktem Maße auch jüngere Menschen. Während die schulische Förderquote zwischen 2009 und 2014 um 12,8vH anstieg, ist sie im außerschulischen Bereich (Bestand an Rehabilitanden zur beruflichen Ersteingliederung, jeweils im Dezember im Verhältnis zur Gesamtzahl der Absolventen/Abgänger allgemeinbildender Schulen) um 23,6vH[3] gesunken (eigene Berechnung anhand BA 2015, 8; 2010, 7; StBA 2015a, 405; KMK 2016, 4). Natürlich kann dies auch Ausdruck wohnort- und betriebsnäherer Förderung sein. Doch eine solche Wirkung von Inklusion könnte unter den gegebenen Bedingungen nicht nachgewiesen werden, da „mit den vorliegenden Statistiken die Wege junger Menschen mit Behinderung von der Schule in das Maßnahmen-, Ausbildungs- und Arbeitsmarktsystem nicht analysiert werden können.“ (Niehaus/Kaul 2012, 62)
All dies hebt die Bedeutung berufsbildender Schulen im Inklusionsgeschehen hervor. Sie stehen so oder so vor der Aufgabe, einen wachsenden Anteil förderbedürftiger junger Menschen auf den ersten Ausbildungs- und Arbeitsmarkt vorzubereiten. Zwar lässt sich nicht absehen, wie sich der Inklusionsprozess in der Sekundarstufe I auf die Bildungspositionen der betroffenen Schüler auswirken wird. Doch allein deren statistischen Merkmale verweisen jenseits entsprechender Diagnosen auf auch soziale Zugangsbarrieren: Während der Anteil von Absolventen/Abgängern ohne Hauptschulabschluss aller anderen relevanten Schulformen seit dem PISA-Schock drastisch zurückging, blieb er an Förderschulen eher stabil und machte 2012 mit 72,6vH mehr als die Hälfte aller Betroffenen aus (AGBB 2014, Tab. D7-6web; D7-7web). Außerdem bekleidete 2011 – bemessen am höchsten beruflichen Status der Angehörigen – die überwiegende Mehrheit der Förderschüler in der Jahrgangsstufe 9 einen niedrigen sozioökonomischen Status; ein weit höherer Anteil als unter den Schülern anderer Schulformen (eigene Berechnung anhand ebd., 257).
Behinderte Menschen stellen damit eine Kernklientel sozial und bildungsbenachteiligter Zielgruppen dar. Nach Daten des Mikrozensus lag hier die Erwerbslosenquote der 25- bis unter 45jährigen noch 2009 bei 10,3vH (Nichtbehinderte 7,4). Gleichzeitig blieben 27,6vH der 30- bis unter 45jährigen ohne Berufsabschluss (Nichtbehinderte 13,5) (Pfaff et al. 2012, 237ff.). Sofern der Inklusionsprozess keine einschneidenden Veränderungen erbringt, besteht zugleich wenig Aussicht, dass sich diese Integrationsperspektiven im Zuge des demografischen Wandels verbessern. Die BIBB-IAB Qualifikations- und Berufsfeldprojektionen bis zum Jahr 2030 fassen zum einen zusammen: „Für die Personen ohne abgeschlossene Berufsausbildung (…) verläuft die Entwicklung von Angebot und Nachfrage in fast allen Regionen sehr ähnlich. Deren ohnehin schon schwierige Arbeitsmarktsituation wird sich weiter verschlechtern“ (Zika et al. 2015, 7). Zum anderen hatte nach einer repräsentativen Umfrage, „nur ein geringer Anteil von 24,1 % der ausbildungsberechtigten Unternehmen in Deutschland junge Menschen mit Behinderungen gegenwärtig (…) oder in den letzten fünf Jahren ausgebildet“ (Enggruber/Rützel 2014, 28). Die anhaltende Benachteiligung behinderter Menschen auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt ist darum auch und vor allem eine soziale Problematik, deren pädagogische Lösung berufsbildende Schulen vor erhebliche Anforderungen stellt.
Für diese Herausforderung sind gerade berufsbildende Schulen allerdings in oft unbekannter Weise gerüstet. Gerade Bildungsgänge des schulischen Übergangssystems, insbesondere das BVJ, werden immer schon implizit inklusiv umgesetzt. Bundesweit wiesen im Schuljahr 2011/12 29vH der BVJ-Schüler einen originären sonderpädagogischen Förderbedarf auf (AGBB 2014, 183). Gerade in Niedersachsen besuchen alle Jugendlichen mit den Förderschwerpunkten Lernen und emotionale und soziale Entwicklung bereits jetzt eine berufsbildende Schule (Hoops zit. n. Bojanowski 2012, 9). Entsprechend wird Inklusion hier einerseits eher geringere Veränderungen im Sinn zusätzlicher Schüler auslösen. Andererseits kann davon ausgegangen werden, dass gerade in diesem Bildungssegment längst pädagogische Kulturen bestehen, an die bei der Umsetzung Inklusiver Schule angeschlossen werden kann.
Diese Gegebenheiten sind aber regional höchst verschieden.Längst ist bekannt, dass die schulischen Förderquoten zwischen den einzelnen Bundesländern variieren (Powell 2004, 5). Dies ist sicher die Folge „unterschiedliche[r] Förderbegriffe und Diagnosestandards“ (Klemm 2015, 11). Doch es lässt auch vermuten, regional unterschiedlich zusammengesetzte Zielgruppen anzutreffen, denen sich pädagogische Kulturen und institutionelle Rahmenbedingungen angepasst haben und deren besondere Ausrichtungen wiederum auf die Bildungs- und Lebenssituationen der Jugendlichen zurückwirken. Entsprechend stellen sich Fragen nach Möglichkeiten, derart korrespondierende Unterschiedlichkeiten im Sinn überregionaler Regelmäßigkeiten zu identifizieren, um übertragbare Handlungsempfehlungen zur Umsetzung Inklusiver Schule formulieren zu können.
2 Forschungsprojekt und Untersuchungsdesign
Diesen grundsätzlichen Fragen sind wir im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Projekts TIM –„Teilhabe und Inklusion im Übergang Schule-Beruf Modellregion Lüneburg“ nachgegangen.[4] Dabei handelte es sich um ein Innovationsvorhaben zur Entwicklung und Erprobung exemplarischer Beschulungskonzepte im Vorfeld der verpflichtenden Umsetzung Inklusiver Schule an allen berufsbildenden Schulen in Niedersachsen. Das durch den Europäischen Sozialfonds und das Land Niedersachen geförderte Projekt wurde ab dem Schuljahr 2013/14 über zwei Jahre durch das Göttinger Institut für berufsbezogene Beratung und Weiterbildung (ibbw-consult) an drei ausgewählten Standorten im Konvergenzgebiet des ehemaligen Regierungsbezirks Lüneburg konzeptionell begleitet und umgesetzt. Der wissenschaftlichen Begleitung kam dabei die Aufgabe einer formativen Evaluation im Sinne der Intervention durch Konzeptvorschläge und der Formulierung möglichst übertragbarer Handlungsempfehlungen zu.
Wir haben diesen Anforderungen erstens durch eine zunächst überregionale Analyse der verfügbaren statistischen Daten gerecht zu werden versucht. Dabei wurde anhand unterschiedlicher Strukturmerkmale eine föderale Gebietstypologie erstellt, in die sich die relevanten Besonderheiten der elf Landkreise des Konvergenzgebiets einlesen ließen. Die letztendlich ausgewählten drei Standorte konnten so als exemplarische Umsetzungsorte in einen überregionalen Zusammenhang gestellt werden.
Zweitens kam es uns darauf an, die umgesetzten Inklusionskonzepte als komplexe Interaktionen zwischen gestalteten Lebenssituationen, pädagogischem Handeln und regionalen Gegebenheiten fassen zu können. Entsprechend haben wir ein forschungsmethodologisches Differenzierungsschema von vier korrespondierenden Prozessebenen entwickelt: Im Kontext „individueller Förderplanung“ geht es zunächst darum, wie Jugendliche jenseits ggf. diagnostizierter Förderschwerpunkte in ihrem lebensweltlichen Bewältigungshandeln wahrgenommen werden und auf dieser Grundlage Bildungskonzepte, Berufsperspektiven und weitere Interventionspläne entstehen. Diese Ebene korrespondiert mit dem „Gruppenkontext und interaktiven Rollenaufbau“ als der Weise, mit der sich individuelle Förderansätze in Lernsituationen übersetzen. Sofern Inklusion nicht als bloßes Dabeisein umgesetzt wird, kommt es darauf an, mit welchem Image und aus welcher Rolle heraus Jugendliche in kommunikativen Klassenverbänden zu lernen vermögen. Inwieweit dies gelingt, ist von der „institutionellen Differenzierung und Kooperation“ als dem Modus abhängig, mit dem Unterschiedlichkeiten pädagogischer Klassenkulturen innerhalb einer Bildungsinstitution reflektiert und für die bedarfsgerechte Inklusion einzelner Jugendlicher genutzt werden. An berufsbildenden Schulen sind greifbare Berufsperspektiven schließlich entscheidende Motoren für die Entwicklung von Lernmotivationen und Bildungskonzepten. Insofern stellen sich auf einer letzten Prozessebene Fragen nach den Beschaffenheiten „regionaler Inklusionsmanagements“, in denen Vertreter von Bildungsträgern, Betrieben und weiteren Förderinstanzen kooperieren.
Diese vier Prozessebenen denken wir wie eine kommunikative Kette, an der entlang die Fähigkeiten und Wünsche einzelner Jugendlicher gleich einem Auftrag kommuniziert werden. Jede einzelne Ebene haben wir in vier hier nicht näher beschriebene Handlungsdimensionen gegliedert und auf der Grundlage dieser Differenzierung Erhebungsinstrumente für folgende Untersuchungsverfahren entwickelt bzw. angepasst:
- Teilstandardisierte Schülerbefragung (n=55),
- Teilstandardisierte Lehrerbefragung (n=160),
- Experteninterviews mit lokalen schulischen und außerschulischen Akteuren (n=8),
- Ethnografische Sondierungen in ausgewählten Unterrichtssequenzen,
- Formulierung übertragbarer Handlungsempfehlungen in Abstimmung mit lokalen den Projektteams.
3 Regionale und überregionale statistische Standortanalyse
Die Bedingungen für die Umsetzung des Inklusionsprozesses unterscheiden sich unter den Bundesländern allein anhand der Ausmaße schulischer und außerschulischer Förderquoten. Um zumindest Hypothesen über diesbezügliche Regelmäßigkeiten bilden zu können, haben wir folgende Strukturmerkmale in ein Verhältnis gesetzt:
- Schulische Förderquote: prozentualer Anteil der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf an allen Schülern mit Vollzeitschulpflicht in Förderschulen und sonstigen allgemeinbildenden Schulen im Schuljahr 2012/2013 (AGBB 2014, Tab. H3-16web);
- Außerschulische Förderquote: Bestandszahlen der von der Bundesagentur für Arbeit für Dezember 2012 zur Ersteingliederung ausgewiesenen Rehabilitanden in Relation zur Gesamtzahl der Absolventen/Abgänger allgemeinbildender Schulen 2012 (eigene Berechnung anhand BA 2013a, 13; StBA 2015a, 400ff.);[5]
- AQI: Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Ausbildungsmarkt; festgemacht an der Angebotsquote zugunsten der Ausbildungsinteressierten (Ulrich et al. 2014, 39);
- Übergangssystem: Anteil der Einmündungen in das Übergangssystem an allen Neuzugängen in das berufliche Ausbildungssystem (Teilsystemquote) (AGBB 2014, Tab. E1-7web);
- Bevölkerungsdichte: Einwohner je km2 2011 (StBA 2013, 27);
- Wanderungssalden 18- bis 25jähriger über die Grenzen der Bundesländer je 1.000 Einwohner (StBA 2014, 21ff.);
- BIP pro Kopf: Bruttoinlandsprodukt – in jeweiligen Preisen – je Einwohner in EURO 2012 (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2014);
- ALO U25: Arbeitslosenquoten Jüngerer zwischen 15 bis unter 25 Jahren – bezogen auf alle zivilen Erwerbpersonen im Jahresdurchschnitt (BA 2013b, 64);
- Armutsgefährdungsquote nach dem Nationalkonzept (gemessen am Bundesmedian) (StBA 2015b, 180).
Die Ergebnisse wurden für diese Veröffentlichung teilweise aktualisiert und zur vereinfachten Darstellung gebietsgruppenübergreifende Mittelwerte gebildet (vgl. Tab. 1).
Für die weitere Hypothesenbildung wurden folgende Schlussfolgerungen gezogen:
Erstens lassen sich keine Zusammenhänge zwischen schulischen und außerschulischen Förderquoten und den Angebots-Nachfrage-Relationen auf den regionalen Ausbildungsmärkten erkennen. Im Gegenteil: Je weniger interessierte Jugendliche in einer Region eine betriebliche Ausbildung antreten, desto geringer ist die außerschulschulische Förderquote. Und je höher die schulische Förderquote ausfällt, desto relativ seltener kommt es zu Einmündungen in Bildungsgänge des Übergangssystems. Es scheint, als hätten sich behindertenspezifische Förderungen weitgehend vom beruflichen Bildungssystem entkoppelt und als würden die betroffenen Jugendlichen zumindest teilweise in exklusiven Bereichen gefördert.
Zweitens korrelieren die schulischen Förderquoten mit der Besiedlungsdichte und dem regionalen Wanderungsverhalten jüngerer Menschen. Sonderpädagogische Förderbedarfe treten sowohl vermehrt in abwanderungsintensiven Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte als auch in zuwanderungsstarken Ballungsgebieten auf. Dies trifft nicht auf den Umfang der außerschulischen Förderquoten zu, was seinen Grund auch in lokal geringeren Vorkommen von Fördereinrichtungen haben könnte.
Drittens ist ein Zusammenhang zwischen regionalem Wohlstandsniveau, Arbeitslosigkeit und den Ausmaßen schulischer Förderquoten auffällig. Eine solche Korrelation, die sich für Niedersachsen bereits zwischen regionalen Mindestsicherungsquoten und schulischen Leistungserfolgen andeutet (MS 2014, 183), lässt sich also offenbar auf den Bereich sonderpädagogischer Förderbedarfe übertragen. Sie häufen sich in strukturschwachen Peripherien wie auch in prosperierenden städtischen Räumen mit ebenfalls hohen Armutsanteilen. Behinderungen treten offenbar grundsätzlich gehäuft in besonders reichen und in besonders armen Gegenden auf. Insgesamt scheint ihr Ausmaß in Zusammenhang mit dem lokalen Vorkommen von Armut und Arbeitslosigkeit zu stehen.
Tabelle 1: Ausgewählte Bezugsgrößen regionaler Förderarrangements im überregionalen Vergleich (Mittelwerte der in den Gebietsgruppen enthaltenen Länderwerte 2012)
| Stadtstaaten | Westdeutsche Flächenländer | Ostdeutsche Flächenländer | |
| Schulische Förderquote | 7,3vH | 6,2vH | 8,8vH |
| Außerschulische Förderquote (2011) | 13,7vH | 14,3vH | 34,6vH |
| AQI | 69,6vH | 71,4vH | 74,2vH |
| Übergangssystem | 22,5vH | 28,8vH | 16,2vH |
| Bevölkerungsdichte | 2628,7 | 279,3 | 126,0 |
| Wanderungssalden | 68,2 | 10,6 | -2,2 |
| BIP pro Kopf | 43.003 EUR | 33.788 EUR | 23.465 EUR |
| ALO U25 | 9,4vH | 5,3vH | 9,3vH |
| Armutsgefährdungsquote | 19,5vH | 13,9vH | 19,5vH |
Dies alles kann auf institutionelle Rahmenbedingungen, wie Diagnosestandards, einer ungleichen Verteilung von Förderstandorten oder die Besonderheit des krisenhaften Transformationsprozesses in den ostdeutschen Bundesländern, zurückführbar sein.
Wir vermuteten jedoch einen weiteren Zusammenhang: Seit der beginnenden Neuzeit entwickelte sich in allen westeuropäischen Ländern eine Dichotomie institutioneller Hilfesysteme. Sie waren strikt am Kriterium der Arbeitsunfähigkeit orientiert und insofern eng mit der Klassifizierung von Behinderungen verbunden. In Deutschland unterschieden sie bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts zwischen mobilen und ortsansässigen Gruppen. Erstere wurden strikt diszipliniert, letztere eher mit dem Anspruch von Fürsorge alimentiert (Koch/Bojanowski 2013, 52ff.). Im Zuge vorangegangener Studien konnten wir insofern eine Fortsetzung dieser Differenzierung feststellen, als dass die Dauer der Ortsansässigkeit weiterhin auf die Positionierung im Bildungs- und Erwerbstätigkeitssystem wirkt (Koch 2013; Tunsch/Koch/Bojanowski 2013). Außerdem wurde deutlich, dass nicht nur der Umfang, sondern auch die Gewichtung der Bildungsgänge des Übergangssystems erheblich zwischen peripheren Abwanderungsgebieten und urbanen Ballungsgebieten variiert (Koch 2012, 33f.; Bals/Koch 2012). Unsere Schlussfolgerung bestand in der Annahme einer fortdauernden Differenzierung benachteiligter Zielgruppen in ortsverbundene und mobile Akteure. Bei ersteren würde es sich demnach um Nachkommen lokaler Unterschichten handeln, deren niedrige Klassifizierung über den Wegfall ehemals eingenommener Berufspositionen hinaus im zeitgenössischen Übergangssystem fortwirkt. Im zweiten Fall hätten wir es mit Protagonisten zu tun, die mit dem Ausfall derartiger Positionen in die Anonymität urbaner Ballungsgebiete abwandern und damit auch die soziale Identität einer Klassifizierungstradition hinter sich lassen.
Die oben beschriebene schichtspezifische Zusammensetzung ließ uns weitergehend annehmen, dass diese Differenzierung zu erheblichen Anteilen auch die Adressaten des Inklusionsprozesses betrifft. Dies würde Behinderungen immer in Relation zu einem entweder ortsgebundenen oder traditionslosen Klassifizierungsverhältnis setzen und damit unterstreichen, dass wir es regional mit sehr unterschiedlich zusammengesetzten Zielgruppen, pädagogischen Kulturen und institutionellen Förderarrangements zu tun haben.
Diese Hypothese bestätigte sich vorläufig dahingehend, dass sich vergleichbare Relationen auch unter den elf Landkreisen des Konvergenzgebiets nachweisen ließen. Zwar existieren in dieser insgesamt dünn besiedelten Region keine urbanen Ballungsgebiete (Es gibt nur drei Mittelstädte mit rund 50.000 bis 70.000 Einwohnern, die in Landkreisen mit deutlich höheren Bevölkerungsanteilen liegen). Doch davon abgesehen steigt auch hier die Bevölkerungsdichte mit nur wenigen Abweichungen entgegengesetzt zum Niveau der Jugendarbeitslosigkeit und den Förderschulbesuchsquoten (die Niedersächsische Landesstatistik weist bislang keine Integrationsschüler aus). Während wir 2012 etwa in Harburg als dem Kreis mit der höchsten Bevölkerungskonzentration (202,2 Einwohner pro km2) eine jahresdurchschnittliche Jugendarbeitslosenquote von 4,2vH und eine Förderschulbesuchsquote von 2,3vH vorfanden, lagen dieselben Werte im am dünnsten besiedelten Lüchow-Dannenberg (40,0 Einwohner pro km2) bei ganzen 9,3vH bzw. 5,5vH (LSN 2001-2014a; 2001-2014b; BA 2013c, 26; eigene Berechnung). Dies galt in ähnlicher Weise auch für den Umfang der außerschulischen Förderquote, den allgemeinen Bevölkerungsreichtum und die regional verbreitete Armut, die sich aufgrund lückenhafter statistischer Grundlagen jedoch nur mit eingeschränkter Vergleichbarkeit ermitteln ließen. Schließlich konnten wir feststellen, dass sich innerhalb der einzelnen Kreise Jugendarbeitslosigkeit und Förderschulbesuchsquoten deutlich abweichend von der Bevölkerungsverteilung auf ländliche Peripherien, Klein- und Mittelstädte verteilten. Damit erhärtete sich einerseits die Hypothese einer regionsspezifischen Zielgruppendifferenzierung. Andererseits nahmen wir an, innerregional dem föderalen Kontext vergleichbare Stadt-Land-Relationen und Wanderungsbewegungen vorzufinden.
Dementsprechend haben wir eine Gebietstypologie entsprechend der unterschiedlichen Besiedlungsstrukturen entwickelt. Die auf dieser Grundlage vorgenommene Standortauswahl betraf folgende drei Regionen (die aufgeführten Werte und Berechnungen beziehen sich auf die zuletzt aufgeführten Angaben):
Uelzen ist mit 64,0 Einwohnern pro km2 einer der am dünnsten besiedelten Kreise in Westdeutschland. Die Jugendarbeitslosigkeitsquote lag im Dezember 2012 mit 7,6vH weit oberhalb des niedersächsischen Durchschnitts. Die noch zu Beginn der 2000er Jahre mit mehr als 4,0vH hoch angesiedelte Förderschulbesuchsquote ist erst vor wenigen Jahren – offenbar aufgrund der Schließung mehrerer Förderschulstandorte – auf 2,3vH in 2012 gesunken. Der Kreis verfügt mit der Stadt Uelzen über ein einziges mittelstädtisches Zentrum mit rund 33.000 Einwohnern. Fast zwei Drittel der Bevölkerung lebt dagegen im großräumigen Umland. Entsprechend der oben beschriebenen Differenzierung gingen wir darum von überwiegend ortsgebundenen Zielgruppen aus.
Rotenburg (Wümme) markiert einen Sonderfall. Zwar liegt die Besiedlungsdichte mit 78,5 Einwohnern pro km² nur unwesentlich höher. Doch eine unterdurchschnittliche Jugendarbeitslosigkeit von 3,9vH verwies im Dezember 2012 auf eine relative Prosperität. Dem stand eine hohe relativ Förderschulbesuchsquote von 3,2vH gegenüber. Diese Widersprüchlichkeit sollte sich im Verlauf der Untersuchung dadurch erklären, dass dem Kreis aufgrund einer ausgeprägten behindertenspezifischen und sozialpädagogischen Infrastruktur erhebliche Teile der Zielgruppen aus überwiegend urbanen Räumen zuziehen. Die im Inklusionsprozess fokussierten Jugendlichen entsprechen darum eher der mobilen Klientel urbaner Ballungsgebieten, obwohl hier neben zwei Mittelzentren drei Viertel der Anwohner in der Peripherie leben.
Lüneburg verweist mit seinem mittelstädtischen Oberzentrum inmitten einer weiträumigen Peripherie bei insgesamt durchschnittlichen Arbeitslosen- und Förderschulbesuchsquoten eigentlich auf regionsinterne Wechselwirkungen. Da hier aber ausschließlich Schüler mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung fokussiert wurden, fällt dieses Merkmal deutlich hinter der Besonderheit dieser Zielgruppe zurück.
Zusammengenommen repräsentiert diese Standortauswahl im Sinn der beschriebenen Zielgruppenhypothese drei unterschiedliche Schwerpunktsetzungen: Eine überwiegend ortsgebundene Klientel (Uelzen), eine eher mobile, traditionslose Zielgruppe (Rotenburg) und ein Personenkreis, dessen Zusammensetzung deutlicher auf einen klassifizierten Förderschwerpunkt zurückgeht.
4 Teilstandardisierte Schülerbefragung
U. a. um diese Hypothese weitergehender zu verifizieren, haben wir in diesen drei Regionen Schüler der jeweils oberen Klassen der mit den berufsbildenden Schulen im Rahmen des Innovationsvorhabens kooperierenden abgebender Förderschulen befragt. Dazu wurde auf einen bereits in anderen Untersuchungen (Koch 2013; Tunsch/Koch/Bojanowski 2013) verwendeten Fragebogen zurückgegriffen, der in Teilen dem Untersuchungsdesign angeglichen wurde. Dabei stellte sich ein für Regionalstudien typisches Problem: Auch wenn wir den statistisch nachweisbaren Zielgruppen angemessene Stichproben von zwischen 50vH und 90vH erreichten, blieben die einzelnen Samples mit n=10 (Lüneburg), n=18 (Uelzen) und n=27 (Rotenburg) doch so begrenzt, dass wir sie als allenfalls eingeschränkt repräsentativ ansehen können. Wir verstehen die erzielten Ergebnisse darum als bloß komplettierende Fundierung durch weitere Verfahren erhärteter Hypothesen. Überdies wurden nur standortbezogene Ergebnisse gegenübergestellt, wenn es dabei zu Ungleichgewichten von mehr als 15vH kam. Schließlich haben wir die in Lüneburg erhobenen Ergebnisse aufgrund einer nicht vergleichbaren Zielgruppe und einer zu begrenzten Stichprobe von der Auswertung ausgenommen.
Zwischen den beiden übrigen Standorten, an denen Schüler mit dem Förderschwerpunkt Lernen befragt wurden, fallen dagegen manifeste Differenzierungen im Sinne unserer Hypothese auf:
Dies betrifft zunächst den Anteil an Jugendlichen, die angaben, in den jeweiligen Landkreisen aufgewachsen zu sein. Er lag in Uelzen (n=18 aus 18) mit fast vier Fünfteln annähernd doppelt so hoch wie in Rotenburg (n=24 aus 27). Dass damit grundsätzlich andere berufsbezogene Sozialisationen verbunden sein mussten, belegen die Ratgeber und Unterstützer bei der Berufswahl, die die Jugendlichen an beiden Standorten benannt haben. Dies waren in Uelzen (n=15 aus 18) zu mehr als zwei Dritteln Familienangehörige; ein Anteil, der in Rotenburg (n=26 aus 27) bei nur rund einem Viertel lag. Dort wurden mit aufgerundet 30vH weit häufiger in Institutionen angesiedelte Ansprechpartner benannt oder sogar noch etwas häufiger darauf verwiesen, in dieser Frage auf sich selbst zurückgeworfen gewesen zu sein. Schließlich spiegelt sich diese Differenzierung auch in den Ausbildungswünschen. Gemäß den Berufshauptgruppen nach der Klassifikation der Berufe 2010 (BA 2013c) gaben in Uelzen (n=13 aus 15) rund zwei Fünftel der Jugendlichen an, einen im weiteren Sinn landwirtschaftlichen Beruf anzustreben. In Rotenburg (n=20 aus 27), wo dieser Anteil nicht einmal ein Sechstel betrug, entfielen mit etwa zwei Fünfteln die meisten Nennungen auf einen sozialen Dienstleistungsberuf.
Fast sinnbildlich illustrieren die beiden Stichproben die unterschiedlichen Voraussetzungen derart differenzierter Zielgruppen. Wo sich Ortsbindung in sozialen (Familien-) Netzwerken und Orientierungen an ländlich tradierten Berufen fortsetzt, verfügen mobile Probanden über kein vergleichbares Sozialkapital. Ihre Bezüge erscheinen porös und ohne Verbindungen zur Region. Es erscheint offensichtlich, dass beiden Zielgruppen ein jeweils besonderer pädagogischer Zugang entspricht. Während bei regionaler Verwurzlung an soziale Beziehungen und ein (wenngleich wahrscheinlich entwertetes) kulturelles Kapital angeknüpft werden kann, erscheint es bei Zugezogenen nötig, überhaupt erst Bezüge zu initiieren und bestehende Orientierungen in einen örtlichen Kontext zu übersetzen.
5 Lehrkräftebefragung[6]
Inwieweit aber waren die verschiedenen Schulstandorte auf diese Klientel vorbereitet? Hatten sie bereits pädagogische Kulturen entwickelt, an die nun im Rahmen von Inklusion angeknüpft werden konnte?
Unter anderem dieser Frage sollte eine Befragung von Lehrkräften an den drei Schulstandorten nachgehen. Dazu wurde ein teilstandardisierter Fragebogen entworfen und unabhängig davon, in welchen Bildungsgängen die befragten Probanden unterrichteten, an sämtliche Lehrer verteilt. Der Rücklauf von 160 ausgefüllten Fragebögen lag an allen drei Standorten zwischen knapp 40vH und etwa 50vH der angegebenen Kollegiumsgrößen. Die hier relevanten Befragungsteile beziehen sich auf die Schwerpunkte „Wissen über Inklusion im Übergang Schule-Beruf“ und „Inklusionsspezifische Kenntnisse, Kompetenzen und Erfahrungen“.
Im ersten Fall ging es darum zu erfahren, in welchem Maße sich die Befragten der Umsetzung Inklusiver Schule – entsprechendem Unterricht, individuellen Förderungen und der Entwicklung von Berufsperspektiven für die betroffen Schüler – gewachsen fühlen. Dabei sollten fünf vorgegebene Aussagen auf einer vierstufigen Likert-Skala hinsichtlich des Grads ihres Zutreffens bewertet werden. Die diesbezüglichen Items konnten darauf mit einem Cronbach-Alpha-Wert von .734 zu einer neuen Skala zusammengefasst werden.
Der zweite Teil bezog sich auf die vier Prozessebenen des dargestellten forschungsmethodologischen Differenzierungsschemas. Hier wollten wir wissen, inwieweit die Befragten – jenseits des Begriffs Inklusion – bereits so etwas wie inklusive Schulpädagogik umsetzen. Die einzelnen Prozessebenen wurden entsprechend der Handlungsdimensionen in jeweils vier Variablen unterteilt, die mit Cronbach-Alpha-Werten von .710, .626, .629 und .717 ebenfalls zu neuen Skalen kombiniert werden konnten.
Die Ergebnisse ließen nur wenige relevante Abweichungen zwischen den einzelnen Standorten erkennen. Gebietsübergreifend zeugen sie jedoch von einer bemerkenswerten Diffusion um den Begriff Inklusion. Nur 22,1vH der Befragten bewerteten die in der Skala zusammengefassten Aussagen zum Wissen über Inklusion als (eher) zutreffend. Die überwiegende übrige Mehrheit schien dagegen verunsichert (vgl. Tab. 2).
Tabelle 2: Begriffliches Inklusionswissen (Zusammenfassung von fünf Selbsteinschätzungen zum Themenbereich „begriffliches Inklusionswissen“ (n=149))
| trifft nicht zu | trifft eher nicht zu | trifft eher zu | trifft völlig zu |
| 14,8vH | 63,1vH | 20,8vH | 1,3vH |
Datenbasis: Preßler 2015, 54
Besonders deutlich wurde dies bei der Bewertung der Einzelaussage: „Ich weiß, wer und was mit diesem Inklusionsprozess auf mich zukommt“, die von rund 87vH der Befragten als (eher) nicht zutreffend bewertet wurde.
Dem stehen jedoch standortübergreifend bemerkenswert andere Angaben hinsichtlich eines bereits praktizierten Inklusionshandelns gegenüber (vgl. Tab. 3):
Tabelle 3: Praktisches Inklusionshandeln (Zusammenfassung von jeweils vier Selbsteinschätzungen)
| trifft nicht zu | trifft eher nicht zu | trifft eher zu | trifft völlig zu | |
| Individuelle Förderplanung (n=148) | 3,4vH | 35,1vH | 58,8vH | 2,7vH |
| Gruppenkontext und interaktiver Rollenaufbau (n=129) | 3,1vH | 31,0vH | 62,8vH | 3,1vH |
| Institutionelle Differenzierung und Kooperation (n=121) | 3,3vH | 47,1vH | 47,1vH | 2,5vH |
| Regionales Inklusions-management (n=130) | 20,0vH | 50,8vH | 28,5vH | 0,8vH |
Datenbasis: Preßler 2015, 54
Insbesondere hinsichtlich der Ebenen „individuelle Förderplanung“ (61,5vH) und „Gruppenkontext“ (65,8vH) gab die überwiegende Mehrheit an, bereits mindestens tendenziell über diesbezügliche praktische Fertigkeiten zu verfügen. Zwar relativierten sich diese Einschätzungen hinsichtlich der weiteren Ebenen der „institutionellen Differenzierung“ und des „regionalen Inklusionsmanagements“. Zusammenfassend lässt sich jedoch festhalten, dass diese Befragung eine erhebliche Diskrepanz zwischen einem alltäglichen Handlungswissen und den begrifflichen Erwartungen an den Inklusionsprozess zu Tage brachte. Praktisch ist die Mehrheit der Befragten nach unserer Einschätzung also zumindest auf den ersten beiden Ebenen mit den Anforderungen an Inklusive Schule vertraut. Doch allein die bloße Benennung des Wortes Inklusion scheint das damit verbundene Selbstvertrauen zu untergraben. Somit zeichnet sich die Notwendigkeit eines reflexiven Umgangs mit pädagogischen Kulturen als alltäglichem Handlungswissen ab, um das, was die Befragten bereits leisten, für eine zielgerichtete Umsetzung Inklusiver Schule nutzbar machen zu können.
6 Profilierung der Standorte[7]
Welcher Art aber sind nun die pädagogischen Kulturen und institutionellen Arrangements, die sich an den unterschiedlichen Standorten herausgebildet haben? Inwiefern sind sie den lokalen Zielgruppen angepasst und gelingt es, an diese Potenziale mit den entwickelten Inklusionskonzepten anzuschließen?
Um dies herauszufinden, haben wir zunächst narrative Experteninterviews (n=8) mit Vertretern der an den Schulstandorten zur Durchführung des Innovationsvorhabens gebildeten Projektteams und zur Ergänzung mit weiteren außerschulischen Ansprechpartnern geführt. Sie orientierten sich im Verlauf an dem oben beschriebenen forschungsmethodologischen Differenzierungsschema. Alle Interviews wurden transkribiert und bei der Auswertung nach der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring 2003) den verschiedenen Prozessebenen zugeordnet. Auf diese Weise – und durch die Teilnahme an den lokalen Projektteamtreffen – konnten wir uns dezidierte Bilder von den Besonderheiten lokaler pädagogischer Schulkulturen und den regional angestrebten Inklusionsvorhaben machen. Dabei wurden jeweils Zentrierungen auf die relevantesten Prozessebenen vorgenommen.
Weiterhin haben wir an jedem Standort ethnographische Sondierungen in exemplarischen Sequenzen inklusiven Unterrichts durchgeführt. Dazu wurden drei wissenschaftliche Hilfskräfte in die Methoden der teilnehmenden Beobachtung und der Ethnografie eingearbeitet und entsprechende Methodenschulungen zum Niederschreiben der Beobachtungen durchgeführt. Das gewonnene Material wurde in der bereits hinsichtlich der Experteninterviews beschriebenen Methode ausgewertet. Schon allein aufgrund seiner Ausschnitthaftigkeit lag der Zweck dieses Verfahrens jedoch nicht in der Produktion wissenschaftlicher Erhebungsergebnisse. Es ging vielmehr um das Einholen einer fundierten Expertise, auf deren Basis wir jeweils gemeinsam mit den involvierten Akteuren vor Ort Handlungsempfehlungen entwickeln konnten, die als Umsetzungsvorschläge für besondere Inklusionsbausteine für andere Standorte übertragbar sein sollten.
Vorab lässt sich festhalten, dass sich die an den Standorten ausgeprägten pädagogischen Kulturen ebenso wie die Modelle Inklusiver Schule den strukturellen Bedingungen und Zielgruppen an den einzelnen Standorten erstaunlich angepasst erwiesen.
6.1 Uelzen: »Ländlicher Raum mit intensiven Sozialbeziehungen«
In Uelzen beginnen Berufsorientierung und die Kontaktaufnahme zu den abgebenden Schulen von jeher lange vor dem eigentlichen Schuljahresbeginn. Dabei erlaubte es gerade die tradierte, ländliche Struktur des Kreises nicht nur an die Lebenswelten der überwiegend ortsgebunden Jugendlichen anzuschließen, sondern auch intensive Kontakte zu Betrieben, Bildungsträgern und zuweisenden Institutionen zu pflegen. Die Intensität kleinstädtischer und ländlicher Sozialbeziehungen wurde also direkt für die Umsetzung individueller Förderkonzepte genutzt.
Entsprechend haben wir die pädagogische Kultur an diesem Standort auf die beiden Prozessebenen Individuelle Förderplanung« und regionales Inklusionsmanagement fokussiert. Das Uelzener Inklusionsmodell baut darauf mit der Verzahnung individueller Förderplangespräche mit der Installation eines Runden Tischs als beratendes Expertengremium (bestehend aus Vertrauenspersonen, Lehrern, Sozialpädagogen und, je nach Bedarf, weiteren regionalen Experten) auf. Es steht im Bedarfsfall grundsätzlich allen Schülern zur Verfügung. Inklusion soll also als universales pädagogisches Prinzip umgesetzt werden. Auf diese Weise werden für die einzelnen Jugendlichen Bildungs- und Förderpläne entworfen, die weit über den Bereich der schulischen Förderung hinaus auf ein regionales Netzwerk von Beschäftigungs- und Förderungsperspektiven verweisen.
Als übertragbare Handlungsempfehlung lässt sich einerseits formulieren, dass die Installation eines solchen Expertengremiums nur in Kombination mit einer vernetzten und kommunikativen Schulkultur umgesetzt werden kann. Dies haben unsere ethnographischen Sondierungen exemplarisch verdeutlicht: In den beobachteten Unterrichtssequenzen trafen wir auf eine pädagogische Vorgehensweise, mit der es gelang, BVJ-Schüler im Rahmen bereits entwickelter Rollen und Stärken zu fördern und zur Ausprägung selbstständiger Lernstrategien zu animieren. Dies verhalf in der Lebenswelt ausgeprägten Potenzialen zu einer bildungsbezogenen Umsetzung, ließ Raum für individuelle Beratungsgespräche entstehen und bot so eine Grundlage, auf der die weitergehende Expertise des Runden Tisches sinnvoll aufbauen kann.
Allerdings waren sich die involvierten Akteure andererseits darin einig, dass die im pädagogischen Alltag entwickelten Sichtweisen auf die Rollen und Stärken der Jugendlichen nur dann in diesem Gremium geltend gemacht werden können, wenn ihnen ein adäquater Stellenwert gegenüber anderen Diagnoseverfahren eingeräumt wird.
6.2 Rotenburg: »Ländliche Zuzugsenklave für (sonder-) pädagogische Förderbedarfe«
Auch in Rotenburg erwies sich die pädagogische Kultur gerade in der Berufsvorbereitung den regionalen Gegebenheiten erstaunlich angepasst. Hier konzentriert sich der pädagogische Schwerpunkt auf die zweite Prozessebene des Gruppenkontexts und interaktiven Rollenaufbaus. Die Jugendlichen werden überwiegend erst nach Schuljahresbeginn berufs- und bildungsbezogen beraten. Sie können im Rahmen der Zugangsvoraussetzungen mögliche Schulformen frei wählen und in sechswöchigen Schnupperphasen erproben. Dies markiert einen Prozess ständiger Klassenbildung, der auf den kontinuierlichen Zuzug mobiler Schüler ausgerichtet ist und im Rahmen freizeitpädagogischer Aktivitäten auf die permanente Formierung interaktiver Lerngruppen zielt.
Das konzipierte Modell Inklusiver Schule sieht vor, dass es im pädagogischen Alltag keine Rolle spielen soll, ob die betroffenen Jugendlichen jemals einen sonderpädagogischen Förderbedarf aufgewiesen haben. Sie können die zur Auswahl stehenden Bildungsgänge auch über bestehende Zugangsvoraussetzungen hinaus frei wählen und haben an offenen Unterrichts- und Sozialformen teil, die inklusive Gruppenbildungen ermöglichen. Lernrollen entstehen hier also nicht durch den wertschätzenden Bezug auf vor Ort ausgeprägte lebensweltliche Identitäten. Vielmehr wird der interaktive Kontext von Klassenverbänden für die Neuverhandlung von Rollen und Beziehungskonstellationen genutzt.
Diese Zielsetzung setzte sich im Zusammenhang mit den von uns durchgeführten ethnographischen Sondierungen erstaunlich erfolgreich um: Die betroffenen Jugendlichen waren im Sinne von Inklusion keine zusätzlichen Schüler, wären unter anderen Umständen aber wohl niedrigschwelligeren Klassen zugewiesen worden. In den nunmehr frequentierten Bildungsgängen mit höheren Zugangsvoraussetzungen konnten sie weder sozial noch hinsichtlich ihrer Lernerfolge als ehemalige Förderschüler identifiziert werden. Auf der Basis stabiler Beziehungen zu den Lehrkräften, offener Sozialformen und Unterrichtsmethoden gelangen ihnen überraschende Lernerfolge. Inklusion ist, so lässt sich als übertragbare Handlungsempfehlung formulieren, also auch und gerade in Regionen mit tendenziell zugezogenen Zielgruppen durchaus möglich. Um originäre Bildungs- und Leistungsunterschiede auszugleichen, lassen sich im Rahmen offener Unterrichtsmethoden gleichberechtigte soziale Rollen in differenzierte Lernrollen übersetzen.
Allerdings brachte dieses besondere Inklusionsmodell auch ein pädagogisches Paradoxon zutage: Die Teilhabe an Schulformen mit höheren Zugangsvoraussetzungen bedeutete auch die Beschulung in größeren Klassenverbänden. Während das Niedersächsische BVJ hier geringe Klassenstärken und darum intensivere Fördermöglichkeiten vorsieht, ging die Teilnahme an einer Niedersächsischen Berufseinstiegklasse oder Berufsfachschule für diese Schüler mit einer geringeren Förderintensität einher.
6.3 Lüneburg: »Mittelstädtisches Bildungszentrum mit multiplen Kooperationsbezügen«
In Lüneburg schließlich knüpft das besondere Inklusionsvorhaben an eine langjährige Kooperation mit einer ansässigen Schule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung an. Hier wurden die betroffenen Schüler zunächst vorwiegend räumlich am Lernort der berufsbildenden Schule in weitgehend geschlossenen Klassenverbänden unterrichtet.
Im Rahmen des Inklusionsmodells werden nun »Inklusionsklassen« eingerichtet. Sie stellen einerseits geschützte Lernräume und damit eine Art Ausgangsbasis für die Teilhabe an weiteren Bildungsgängen der Berufsvorbereitung dar. Andererseits findet eine dauerhafte und regelmäßige Öffnung des Fachpraxisunterrichts statt. Damit stellt sich das Lüneburger Modell zunächst als organisatorische Zusammenführung zweier Schulformen in einem gemeinsamen schulpädagogischen Lernkontext dar.
Entsprechend konzentriert sich der Schwerpunkt dieses Modells auf der Prozessebene institutioneller Differenzierung und Kooperation.
Doch die Realisierung dieses Modells verdeutlicht zugleich die ungeheuren pädagogischen Anforderungen, die eine solche institutionelle Zusammenführung mit sich bringt. Denn der gemeinsame Unterricht derart unterschiedlicher Zielgruppen macht die Überbrückung einer erheblichen Kluft unterschiedlicher Lernvoraussetzungen und bildungssozialisatorischer Hintergründe notwendig. Doch gerade in diesem Punkt bewährt sich das Lüneburger Modell in einer für andere Standorte übertragbaren Weise. Denn allein die Anzahl der betroffenen Jugendlichen ermöglicht die ständige Anwesenheit einer Förderschullehrkraft, was zum einen die teilweise Beibehaltung geschützter Klassenverbände gestattet und zum anderen die Voraussetzungen für ein inklusives Teamteaching wie für individuelle Förderungen während des Unterrichts schafft.
Trotzdem offenbart das Lüneburger Modell auch eine grundsätzliche Problematik der Inklusiven Schule: Der gemeinsame Unterricht von Schülern mit derart unterschiedlichen Lernvoraussetzungen stellt die Frage nach der Differenzierung von Bildungszielen: Junge Menschen mit diagnostiziertem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung können in aller Regel schwerlich die etwa in einer Niedersächsischen Berufseinstiegsklasse gegebenen Anforderungen erfüllen. Inklusive Schule kann hier also nur dann erfolgreich sein, wenn die Lernziele differenziert und mit gleichberechtigten Berufsperspektiven auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt verknüpft sind. Für das erste Problem könnten veränderte Zertifizierungen im Sinne inklusiver Qualifizierungsbausteine eine für andere Standorte übertragbare Lösung darstellen. Doch insgesamt verweist dieses Problem noch einmal eindringlich auf die Notwendigkeit eines für den Inklusionsprozess geöffneten Arbeits- und Ausbildungsmarkts.
7 Resümee und Ausblick
Zusammenfassend haben die verschiedenen Erhebungsverfahren unserer Untersuchung ein konsistentes Gesamtergebnis erbracht: Die auf überregionaler Ebene festgestellten Differenzierungen unterschiedlich ausgeprägter Förderquoten ließen sich auch auf den regionalen Kontext des Konvergenzgebiets übertragen. Weiterhin wurde deutlich, dass dem auch örtlich ausgeprägte pädagogische Kulturen entsprachen. Zwar wurden die damit verbundenen Erfahrungen meist nicht als Potenziale für die Umsetzung des Inklusionsprozesses erkannt. Trotzdem konnten sie als Ausgangsbedingungen für die Entwicklung regionaler Inklusionskonzepte genutzt werden. Zusammenfassen lassen sich auf dieser Grundlage folgende Handlungsempfehlungen verallgemeinern:
Inklusion im Übergang Schule-Beruf fungiert wie ein Vermittlungsscharnier zwischen weiterhin wachsenden Förderquoten an allgemeinbildenden Schulen und neuerdings relativ rückläufigen Anerkennungen jüngerer Rehabilitanden. Berufsbildende Schulen müssen also einen wachsenden Anteil meist auch sozial und bildungsbenachteiligter junger Menschen auf den ersten Arbeits- und Ausbildungsmarkt vorbereiten.
Inklusion ist als interaktiver Prozess auf unterschiedlichen Prozessebenen zu verstehen. Ein individuelles Verstehen lebensweltlichen Bewältigungshandelns, die Formulierung von Förderzielen und Berufsperspektiven verbindet sich mit der Ausprägung entsprechender Lernrollen in interaktiven Gruppenkontexten. Die Herausbildung solcher Klassenkulturen ist jedoch von einer institutionellen Differenzierung und Kooperation abhängig, mit der einzelnen Klassen besondere Schwerpunkte zugedacht werden. All dies funktioniert nur im Rahmen eines regionalen Inklusionsmanagements, mit dem sich individuelle Lernziele mit umsetzbaren (Berufs-) Perspektiven verbinden.
Die Anforderungen an Inklusion im Übergang Schule-Beruf sind allerdings regional sehr verschieden. Insbesondere schulische Förderquoten konzentrieren sich in strukturschwachen Abwanderungsregionen ebenso wie in zuwanderungsstarken Ballungsgebieten. Dies verweist bis in den Besiedlungsstrukturen einzelner Landkreise hinein auf eine grundsätzliche Differenzierung der Zielgruppen in Angehörige örtlich verwurzelte Unterschichten und mobilen Klientelen mit geringerer lebensweltlicher Ortsbindung. Für berufsbildende Schulen kommt es darum darauf an, sich der Besonderheit der regional angetroffenen Zielgruppen bewusst zu werden.
An den Lernorten insbesondere Niedersächsischer berufsbildender Schulen werden insbesondere in der Berufsvorbereitung traditionell junge Menschen mit diagnostizierten sonderpädagogischen Förderbedarfen unterrichtet. Sie stellen damit den einzigen regelschulischen Lernort mit impliziter Inklusionserfahrung dar. Diese Erfahrung wird von einem Großteil der Lehrkräfte jedoch nicht in Zusammenhang mit dem Inklusionsprozess gebracht. Auf der Basis unterschiedlicher regionaler Gegebenheiten, spezifischer Zielgruppen und institutioneller Förderarrangements bilden sich jedoch besondere pädagogische Kulturen heraus, in denen die Möglichkeiten einer Umsetzung von Inklusion bereits angelegt sind. Diese pädagogischen Kulturen und institutionellen Arrangements gilt es zu reflektieren und auf veränderte inklusive Bildungsziele zu beziehen.
Literatur
AGBB (Autorengruppe Bildungsberichterstattung) (2014): Bildung in Deutschland 2014: Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zur Bildung von Menschen mit Behinderungen. Online: http://www.bildungsbericht.de/index.html?seite=11123 (16.03.2016).
BA (Bundesagentur für Arbeit) (2010): Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Arbeitsmarkt in Zahlen – Förderstatistik. Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben – Rehabilitanden. Berichtsmonat: Dezember 2009. Online: https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/
Detail/200912/iiia5/rf-reha/reha-d-0-pdf.pdf (21.03.2016).
BA (Bundesagentur für Arbeit) (2013a): Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Arbeitsmarkt in Zahlen – Förderstatistik. Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben - Rehabilitanden, Nürnberg, Dezember 2012. Online: https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/
201212/iiia5/rf-reha/reha-d-0-pdf.pdf (16.03.2016).
(BA) Bundesagentur für Arbeit (2013b): Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Arbeitslosenstatistik, Arbeitslosenquoten, Jahreszahlen 2012. Deutschland nach Kreisen, Länder, Agenturen für Arbeit und Regionaldirektionen. Online: https://statistik.
arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/201212/iiia4/monats-jahresquoten/monats-jahresquoten-d-0-pdf.pdf (21.03.2016).
(BA) Bundesagentur für Arbeit (2013c): Klassifikation der Berufe 2010 – Systematisches Verzeichnis. Online: https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Grundlagen/Klassifikation-der-Berufe/KldB2010/Systematik-Verzeichnisse/Generische-Publikationen/Systematisches-Verzeichnis-Berufsbenennung.xls (19.10.2014).
BA (Bundesagentur für Arbeit) (2015): Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Arbeitsmarkt in Zahlen – Förderstatistik. Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben – Rehabilitanden. Berichtsmonat: Dezember 2014. Online: https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/201412/iiia5/rf-reha/reha-d-0-201412-pdf.pdf (21.03.2016).
Bals, T./Koch, M. (2012): Zur Komplexität und Empirie des Übergangssystems – Erfassung und Analyse des Übergangssystems in der Region Osnabrück, Paderborn.
Bojanowski, A. (2012): Expertise für den Nationalen Bildungsbericht 2014: Berufliche Inklusion Behinderter und Benachteiligter. Online: http://www.bildungsbericht.de/daten/bojanowski1112.pdf (14.03.2016).
Bundesanstalt für Arbeit (1980): Berufliche Rehabilitation. Arbeits- und Berufsförderung Behinderter in den Jahren 1976 bis 1978. Online: https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/197812/anba/rehabilitation/rehabilitation-d-0-pdf.pdf (14.03.2016).
Bundesanstalt für Arbeit (1996): Berufliche Rehabilitation. Arbeits- und Berufsförderung Behinderter im Jahre 1995. Online: https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/199512/anba/rehabilitation/rehabilitation-d-0-pdf.pdf (14.03.2016).
DGB (DGB Bundesvorstand Abteilung Arbeitsmarktpolitik) (2012): Zur Lage der beruflichen Rehabilitation in der Arbeitsförderung. Arbeitsmarkt aktuell 7/2012. Online: http://www.dgb.de/themen/++co++1d5fe9a8-12a5-11e2-b676-00188b4dc422 (20.03.2016).
Enggruber, R./Rützel, J. (2014): Berufsausbildung junger Menschen mit Behinderungen. Eine repräsentative Befragung von Betrieben im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Online: https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/GP_Berufsbildung_junger_Menschen_mit_Behinderungen.pdf (16.03.2016).
Herz, B. (2013): Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung: Kritische Einschätzung der zukünftigen Entwicklung. Online: https://www.ifs.phil.uni-hannover.de/fileadmin/sonderpaedagogik/Abteilung_Verhalten/Downloads/EusE_Kritische_Einschaetzung.pdf (23.03.2016).
KMK (Statistische Veröffentlichung der Kultusministerkonferenz) (2010): Sonderpädagogische Förderung in Schulen 1999-2008. Dokumentation Nr. 189. Online: http://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Statistik/Dokumentationen/Dok_189_SoPaeFoe_2008.pdf (14.03.2016).
KMK (Statistische Veröffentlichung der Kultusministerkonferenz) (2016): Sonderpädagogische Förderung in Schulen 2005-2014. Dokumentation Nr. 210. Online: https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Statistik/Dokumentationen/Dok_210_SoPae_2014.pdf pdf (14.03.2016).
Keune, S. et al. (1996): Berufliche Ersteingliederung von Menschen mit Behinderungen in den neuen Bundesländern. Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.) Wissenschaftliche Diskussionspapiere H. 25. Online: https://www.bibb.de/dokumente/pdf/wd_25_berufliche_ersteingliederung.pdf (14.03.2016).
Klemm, K. (2015): Inklusion in Deutschland. Daten und Fakten. Studie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Online: https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_IB_Klemm-Studie_Inklusion_2015.pdf (18.03.2016).
Koch, M. (2012): Die Wiederkehr des Vagabunden. Zur Klassifizierungsgeschichte benachteiligter Jugendlicher im Übergangssystem. In: Bojanowski, A./Eckert, M. (Hrsg.): Black Box Übergangssystem. Münster, 23-36.
Koch (2013): »Verschüttetes Können?« Kompetenz, Herkunft und Habitus benachteiligter Jugendlicher. Münster.
Koch, M./Bojanowski, A. (2013): Deklassierende Dispositive. Zur kulturgeschichtlichen Dimension des zeitgenössischen Übergangssystems. In: Maier, M.S./Vogel, T. (Hrsg.): Übergänge in eine neue Arbeitswelt. Blinde Flecken der Debatte zum Übergangssystem Schule-Beruf. Wiesbaden, 49-68.
Koch, M./Preßler, N. (2015): Wissenschaftliche Begleitung des Innovationsvorhabens Teilhabe und Inklusion im Übergang Schule-Beruf Modellregion Lüneburg (TIM). Bislang unveröffentlichter Abschlussbericht. Hannover.
LSN (Landesamt für Statistik Niedersachsen) (2001-2014a): Tabelle K3001031. Allgemein bildende Schulen in Niedersachsen zum Schuljahresbeginn. Gebietsstand: 01.03.2013. Schuljahr 2012/2013. Online: http://www1.nls.niedersachsen.de/statistik/html/haupt_suchwahl_unten.asp? TN=K3001031 (12.10.2014).
LSN (Landesamt für Statistik Niedersachsen) (2001-2014b): Tabelle K1001690. Fläche, Bevölkerung und Bevölkerungsbewegung in Niedersachsen (Gebietstand: 1.11.2011). 2012*. Online: http://www1.nls.niedersachsen.de/statistik/html/haupt_suchwahl_unten.asp?TN=K1001690 (12.10.2014).
Mayring P. (2003): Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Weinheim/Basel.
MS (Niedersächsisches Ministerium für Soziales, für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung) (2014): Handlungsorientierte Sozialberichterstattung Niedersachsen. Statistikteile Bericht 2014. Online: http://www.ms.niedersachsen.de/download/88849/ Handlungsorientierte_Sozialberichterstattung_Niedersachsen_-_Statistikteil_2014.pdf (15.03.2016).
Niehaus, M./Kaul, T. (2012): Zugangswege junger Menschen mit Behinderung in Ausbildung und Beruf. Band 14 der Reihe Berufsbildungsforschung. Herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Referat für Grundsatzfragen der beruflichen Bildung. Online: http://www.bmbf.de/pub/band_vierzehn_berufsbildungsforschung.pdf (14.03.2016).
Pfaff, H. et al. (2012): Lebenslagen der behinderten Menschen. Ergebnis des Mikrozensus 2009. In: Statistisches Bundesamt: Wirtschaft und Statistik, März 2012. Online: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/Sozialleistungen/Lebenslagenbehinderte032012.pdf?__blob=publicationFile (15.03.2016).
Powell, J.J.W. (2004): Das wachsende Risiko, als „sonderpädagogisch förderbedürftig“ klassifiziert zu werden in der deutschen und amerikanischen Bildungsgesellschaft. Selbständige Nachwuchsgruppe “Ausbildungslosigkeit: Bedingungen und Folgen mangelnder Berufsausbildung” im Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Working Paper 2/ 2004. Online: https://www.mpib-berlin.mpg.de/volltexte/institut/dok/full/nwg/NWG%20Powell
%20WP2_2004.pdf (14.03.2016).
Preßler, N. (2015): Befragung der Lehrkräfte. In: Koch, M./Preßler, N. (2015): Wissenschaftliche Begleitung des Innovationsvorhabens Teilhabe und Inklusion im Übergang Schule-Beruf Modellregion Lüneburg (TIM). Bislang unveröffentlichter Abschlussbericht. Hannover, 51-57.
Rauch, A./Dornette, J./Schubert, M./Behrens, J. (2008): Berufliche Rehabilitation in Zeiten des SGB II. IAB-Kurzbericht 25/2008. Online: http://doku.iab.de/kurzber/2008/kb2508.pdf (14.03.2016).
Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2014): Bruttoinlandsprodukt – in jeweiligen Preisen – je Einwohner in Deutschland nach Bundesländern. Online: http://www.vgrdl.de/VGRdL/tbls/tab.jsp?rev=RV2014&tbl=tab01&lang=de-DE#tab07 (16.03.2016).
StBA (Statistisches Bundesamt) (2013): Fachserie 1 Reihe 1.3. Bevölkerung und Erwerbstätigkeit Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage der Volkszählung 1987 (Westen) bzw. 1990 (Osten). 2011. Online: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Bevoelkerungsfortschreibung2010130117004.pdf?__blob=publicationFile (16.03.2016).
StBA (Statistisches Bundesamt) (2014): Fachserie 1 Reihe 1.2. Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Wanderungen 2012. Online: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/
Thematisch/Bevoelkerung/Wanderungen/Wanderungen2010120127004.pdf?__blob=publicationFile (16.03.2016).
StBA (Statistisches Bundesamt) (2015a): Fachserie 11 Reihe 1. Bildung und Kultur. Allgemeinbildende Schulen. Schuljahr 2014/2015. Online: https://www.destatis.de/DE/
Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Schulen/AllgemeinbildendeSchulen2110100157004.pdf;jsessionid=9A647FACE5C7712F5BDA4EB79BF0CD21.cae1?__blob=publicationFile (16.03.2016).
StBA (Statistisches Bundesamt) (2015b): Einkommen, Konsum, Lebensbedingungen. In: Statistisches Jahrbuch 2015. Online: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Statistisches
Jahrbuch/EinkommenKonsumLeben.pdf?__blob=publicationFile 161-184 (16.03.2016).
Tunsch, C./Koch, M./Bojanowski, A. (2013): „Entkoppelte Potentiale“ - Untersuchungen in einem „arbeitsmarktfernen“ Stadtteil. Unveröffentlichter Abschlussbericht der Wissenschaftlichen Begleitung zur „Ausbildungsoffensive Stocken“. Hannover.
Ulrich, J.G. et al. (2014): Die Entwicklung des Ausbildungsmarktes im Jahr 2013. Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge fällt auf historischen Tiefstand. BIBB-Erhebung über neu abgeschlossene Ausbildungsverträge zum 30. September. (Fassung vom 20.01.2014). Online: https://www.bibb.de/dokumente/pdf/a21_beitrag_naa-2013.pdf (16.03.2016).
Wittwer, U./Seyd, W. (2004): Das Recht behinderter Menschen auf Teilhabe am Arbeitsleben. Memorandum aus der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Berufsförderungswerke. In: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Ausgabe 6. Online: http://www.bwpat.de/ausgabe6/wittwer_seyd_bwpat6.pdf (14.03.2016).
Zelfel, R. C. (2007): Berufliche Rehabilitation im Wandel von Arbeitswelt und Gesellschaft. Inaugural-Dissertation in der Fakultät Humanwissenschaften der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Online: https://opus4.kobv.de/opus4-bamberg/files/118/D_Zelfel.pdf (14.03.2016).
Zika, G. et al. (2015): Qualifikations- und Berufsfeldprojektionen bis 2030. Engpässe und Überhänge regional ungleich verteilt. IAB-Kurzbericht 9/2015. Online: http://doku.iab.de/kurzber/2015/kb0915.pdf (16.03.2016).
[1] Eigene Recherche am 20.01.2016.
[2] Eigene Berechnung anhand Bundesanstalt für Arbeit 1996, 10.
[3] Die Rückgänge der jährlichen Zugangszahlen fallen in identischer Relation mit einem Absinken um 12,5vH geringer aus (eigene Berechnung anhand BA 2015, 7; 2010, 6; StBA 2015a, 405).
[4] Sofern nicht besonders hervorgehoben, gehen die im Weiteren dargestellten Forschungsergebnisse auf den Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung dieses Innovationsvorhabens zurück (Koch, Preßler 2015).
[5] Hier ist zu beachten, dass sich die errechneten Werte nur teilweise von Einmündungszahlen in berufliche Ausbildung und das Übergangssystem abgrenzen lassen
[6] Der folgende Abschnitt geht inhaltlich auf Preßler (2015) zurück.
[7] Teile dieses Kapitels sind in abgeänderter Form dem Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung (Koch/Preßler 2015) entnommen.
Zitieren des Beitrags
Koch, M. (2016): Inklusion an berufsbildenden Schulen in Niedersachsen: Zur regionalen Differenzierung von Zielgruppen, pädagogischen Kulturen und Handlungskonzepten. In: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Ausgabe 30, 1-20. Online: http://www.bwpat.de/ausgabe30/koch_bwpat30.pdf (24-06-2016).