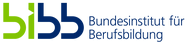Über bwp@
bwp@ ... ist das Online-Fachjournal für alle an der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Interessierten, die schnell, problemlos und kostenlos auf reviewte Inhalte und Diskussionen der Scientific Community zugreifen wollen.
bwp@ 32 - Juni 2017
Betrieblich-berufliche Bildung
Hrsg.: , &
Betriebliche (Handwerks)Bildung im Nationalsozialismus – Eine kritisch-historiografische Untersuchung der nationalsozialistischen Interessen und der NS-Ideologie (im Handwerk) in Hamburg (1933-1945)
Der Betrieb als Lernort in der Dualen Berufsausbildung in Deutschland nimmt nach wie vor eine bedeutende Rolle im Berufsbildungssystem ein, was u. a. die sozialisierende Funktion während der betrieblichen Ausbildung und das Potenzial der politischen Bildung betrifft, die allerdings auch die Möglichkeit einer Ideologisierung zulassen.
Deswegen soll in diesem Beitrag eine kritisch-historiografische Auseinandersetzung mit der betrieblichen Bildung im Nationalsozialismus stattfinden, um die Funktion der beruflichen Sozialisation und der politischen Bildung im Betrieb während der nationalsozialistischen Diktatur darzustellen. Denn Strukturen, Prozesse und Funktionen betrieblicher Bildung werden meist ahistorisiert und sind in der historiografischen Berufsbildungsforschung ein marginales Thema.
Hierzu werden – exemplarisch für die betriebliche Bildung in Deutschland im Nationalsozialismus –sozial- und regionalhistoriografisch die Entwicklungen des Handwerks in Hamburg beleuchtet. Die ideologiekritischen Betrachtungen der betrieblichen (Handwerks)Bildung konzentrieren sich auf die Manifestierung der nationalsozialistischen Ideologie. Zum einem werden die unterschiedlichen Formen der nationalsozialistischen Ideologie in der (Handwerks)Bildung betrachtet, zum anderen werden die (politischen) Funktionen und Interessen herausgestellt, die mit den nationalsozialistischen Veränderungen verbunden waren. Es wird u. a. gefragt: wie und warum eine Umsetzung der nationalsozialistischen Ideologie in der betrieblichen (Handwerks)Bildung in Hamburg erfolgte, welche wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen die Umsetzung und Wirksamkeit der NS-Ideologie hier ermöglicht und gefördert haben und welche (nationalsozialistischen) Interessen für die Entwicklung und den Bedarf betrieblicher (Handwerks)Bildung maßgeblich waren.
Company training (in skilled trades) under the Nazi regime – a critical-historical study of National Socialist interests and ideology (regarding the skilled trades) in Hamburg (1933-1945)
The company as a location of learning for those in dual vocational training is still an important part of Germany’s vocational education and training system. As such, it also plays a role in the socialisation of trainees during in-company training, and potentially in their political education – which can be exploited for ideological purposes.
This paper offers a critical-historical examination of in-company education under the Nazi regime, focusing on the role of the company in the vocational socialisation and political education of trainees at that time. Such an examination is needed because the structures, processes and functions of in-company training are generally de-historicised, and marginal to historical research on vocational education and training.
We therefore examine some social and regional developments in the skilled trades in Hamburg as examples of in-company education in Nazi Germany. Our critical perspective focuses on how National Socialist ideology manifested itself within company training (in the skilled trades). Apart from the various forms Nazi ideology took within (skilled-trades) training, we also look at how the (political) functions and interests associated with that training changed under the Nazi regime. Among other things, we ask: how and why Nazi ideology was introduced into company (skilled-trades) training in Hamburg; what economic, political and social developments facilitated that ideology in becoming established and effective there; and which (Nazi) interests contributed most to the development and demand for in-company (skilled trades) training.
1 Politisierung der betrieblichen Berufsbildung – Fragen und Probleme
Das deutsche Berufsbildungssystem bietet einer Vielzahl an Individuen unterschiedliche Optionen, sich entsprechend ihrer Fähigkeiten beruflich und persönlich zu entfalten und sich auf das Berufsleben vorzubereiten. Der Lernort Betrieb, in dem vorwiegend die berufliche Bildung stattfindet,[1] ist dabei die einflussreichste Institution der Berufsbildung (vgl. Büchter 2015, 91). Insofern kommt der betrieblichen Berufsbildung[2] eine Schlüsselfunktion zu, die gleich mehrere Bezugspunkte umfasst. Zum einen ist damit der Lernort Betrieb[3] gemeint, das didaktische Prinzip (der Praxisbezug) und die Intention der Bildungsmaßnahme – die berufliche Qualifizierung (vgl. Aff/Klusmeyer/Wittwer 2010, 331).
Der Betrieb zählt nicht nur aufgrund des zeitlichen Umfangs zu dem relevantesten Lernort der Berufsbildung, sondern Betriebe bestimmen auch „was, wie und wo betrieblich gelernt wird, […] in welcher Weise das Gelernte verwertet und personalpolitisch genutzt wird und damit, welche Auswirkungen dies auf die persönliche Entwicklung und den Lebenslauf der Beschäftigten hat“ (Büchter 2015, 92). Darüber hinaus eröffnen sich im Betrieb auch viele Möglichkeiten und Aufgaben[4] in Hinblick auf die berufliche Sozialisation und politische Bildung von Jugendlichen, denn die betriebliche Bildung wird politisch von einem Gemisch unterschiedlicher wirtschaftlicher Interessen verschiedener Institutionen umrahmt (Arbeitergeberverbände, Gewerkschaften o. ä.).
Im vorliegenden Beitrag wird betriebliche Berufsbildung als Ort beruflicher Sozialisationsprozesse und politischer Bildung verstanden, der einen wesentlichen Bestandteil von Lernen in der Adoleszenzphase von jungen Menschen ausmacht, denn „in Arbeit, Betrieb und Ausbildung machen die Jugendlichen wichtige Lebenserfahrungen“ (Burger/Seidenspinner 1979, 9). Sie entwickeln in der Auseinandersetzung mit ihrer sozialen/beruflichen Umwelt Einstellungen und Verhaltensweisen, die sich neu entfalten, verfestigen oder verändern; es entstehen (neue) Möglichkeiten ihr Verhalten in Konfliktsituationen anzupassen und ihre eigene Interessen durchzusetzen (vgl. Burger/Seidenspinner 1979, 9; vgl. Lempert 2006, 2). Diese Lern- und Entwicklungserfahrungen, die Jugendliche auf ihre spätere Arbeitstätigkeiten bzw. auf ihren Beruf vorbereiten und die sie im Verlauf ihres Berufslebens noch machen werden, können als berufliche Sozialisation beschrieben werden (vgl. Heinz 1995, 7). Damit gemeint ist „die im betrieblichen Arbeitsprozeß vermittelten Erfahrungen, die das Verhältnis der Erwerbstätigen gegenüber Arbeitsinhalten, betrieblichen Bedingungen und Arbeitsresultaten konkretisiert und im gesamten aktuellen und biographischen Lebenszusammenhang bewußtseinsbildende, persönlichkeitsförderliche, aber auch deformierende Auswirkungen besitzen“ (Heinz 1995, 42 – „Sozialisation durch den Beruf“).
Berufliche Sozialisation beinhaltet nicht nur die Wechselbeziehungen zwischen der beruflichen Umwelt z. B. dem Betrieb als „Sozialisationsinstanz“ und dem Adressaten – des sich sozialisierenden jungen Menschen, sondern betrifft auch jene Interaktionen zwischen dem „Sozialisanden“ und den „Sozialisatoren“, nämlich denjenigen, die in diesem Berufsumfeld sozialisieren und gesellschaftliche Normen und Werte sowie individuelle (politische) Einstellungen und Verhaltensweisen vermitteln (vgl. Lempert 2006, 2), wie z. B. das Ausbildungspersonal, Betriebsinhaber oder andere Lehrlinge (vgl. Kärtner et al. 1984, 17). Sie alle sind auf unterschiedliche Weise für die Berufsausbildung verantwortlich und verhalten sich aufgrund unterschiedlicher Faktoren (Motivation, Einstellung zur Arbeit, Erfahrung usw.) unterschiedlich (vgl. Büchter 2015, 103). Damit ist nicht nur die betriebliche Bildung eng verbunden mit der Professionalität des betrieblichen Bildungspersonals, sondern auch mit deren beruflicher Sozialisation und politischer Bildung.
Das Ausbildungspersonal z. B. versucht, die maßgeblichen Prinzipien, die ihnen den Berufserfolg bzw. den sozialen Aufstieg zum Ausbilder ermöglicht haben, auf die Auszubildenden zu übertragen (vgl. Lempert 2002, 162). „Das heißt, sie bemühen sich vor allem, die Auszubildenden zur Unterwerfung unter den Betriebszweck, zur Anpassung an die Unternehmungskultur und zur Eingliederung in die bestehende betriebliche Hierarchie zu erziehen und ihnen traditionelle formale ‚Arbeitstugenden’ wie Ordnungssinn, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Arbeitsdisziplin zu vermitteln, genau so, wie sie es in ihrer eigenen Ausbildung erfahren haben“ (ebd., 162f.). Arnold (1983) stellt in seiner Studie zur pädagogischen Professionalisierung betrieblicher Bildungsarbeit fest, dass es unterschiedliche Deutungsmuster[5] des betrieblichen Bildungspersonals gibt, die z. T. von ihrer eigenen beruflichen Sozialisation und lebensweltlichen Komponenten abhängen (vgl. Arnold 1983, 165ff.; vgl. Abb. Lempert 2002, 165). Was diese individuellen Sichtweisen und Lebenswelten des Bildungspersonals allerdings für die berufliche Sozialisation ihrer Auszubildenden bedeuten, ist zum einem kaum untersucht (vgl. Büchter 2015, 103) und lässt sich zum anderem nur gering ableiten, da noch viele weitere Personen im Betrieb zur beruflichen Sozialisation (vgl. Lempert 2002, 166) und zur politischen Bildung dieser beitragen. Darüber hinaus müssten ebenfalls die Reaktionen bzw. Veränderungen (Konformismus/Nonkonformismus) der Sozialisanden auf ihre berufliche Sozialisation im Betrieb genauer beleuchtet werden.
Betrachtet man das Ziel betrieblicher Bildungsprozesse, dann kann gesagt sagen, dass „Lehrende […] u. a. die institutionalisierte Aufgabe [haben], jeweils vorgefundene Werteorientierungen und Normen Lernender nach Maßgabe geltender Lehrziel-Vorstellungen zu modifizieren […]“ (Heid 2006, 38). Ein Ziel beruflicher Sozialisation und politischer Bildung ist es, jungen Menschen bei dieser Modifizierung zu helfen, indem sie durch entsprechende betriebliche Bildungsprozesse eine Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit betrieblichen Anforderungen und (Herrschafts)Strukturen entwickeln. Allerdings können Prozesse in der beruflichen Sozialisation und politischen Bildung am Lernort Betrieb auch einen gegenteiligen Effekt erzielen. Der Betrieb als Lernort junger Menschen bzw. die hier handelnden Akteure haben nicht nur die Verantwortung sowohl die berufliche und politische Handlungsfähigkeit als auch die Identitätsfindung ihrer Auszubildenden zu fördern, sondern sie besitzen auch das Potenzial, diese ideologisch zu instrumentalisieren.
Betriebliche Bildung prägt somit nicht nur die Identität von Jugendlichen im Rahmen der beruflichen Sozialisation und politischen Bildung, sondern durch Berufsbildung sind junge Menschen während der adoleszenten Identitätsfindung auch politisch beeinflussbar und somit instrumentalisierbar. Dieser (Macht)Einfluss kann sich unterschiedlich auf die betrieblichen Bildungsstrukturen, -inhalte und -konzepte auswirken. Im Extremfall kann dieser Einfluss auch eine totalitäre (politische) Kontrolle und Instrumentalisierung durch wirtschaftliche und (bildungs)politische Interessen bedeuten, was in der Geschichte besonders in totalitären Systemen wie bspw. dem Nationalsozialismus deutlich geworden ist, wo die betriebliche Bildung zur Manifestierung und Weitergabe nationalsozialistischer Vorstellungen missbraucht worden ist.[6]
Vor diesem Hintergrund der Chancen und Risiken beruflicher Sozialisation und politischer Bildung im Lernort Betrieb besteht der Anspruch dieses Beitrages darin, einerseits darzustellen, wie die betriebliche (Handwerks)Bildung im Nationalsozialismus ideologisiert worden ist und andererseits zu fragen, warum die NS-Ideologie in der betrieblichen (Handwerks)Bildung konstituiert und reproduziert wurde, d. h. welche nationalsozialistischen Interessen im Betrieb verfolgt worden sind.
Dazu wird in dem folgenden Kapitel zunächst der Forschungsstand erläutert und auf Desiderate hingewiesen (Kap. 2). Es folgt eine sozial- und regionalhistoriografische Betrachtung des Handwerks, die auf einige ausgewählte relevante wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Entwicklungen und Wechselbeziehungen eingeht (Kap. 3), um zu verdeutlichen, dass es sich um ein Konglomerat unterschiedlicher Entwicklungen im Handwerk handelt, d. h. dass es sich um eine wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Verflechtung aller in der betrieblichen Berufsbildung vorfindbaren Phänomene handelt. Danach wird die NS-Ideologie in ihren Formen und Funktionen ideologiekritisch betrachtet (Kap. 4), um anhand dieser Ergebnisse die betriebliche (Handwerks)Bildung im Nationalsozialismus in Hamburg zu untersuchen (Kap. 5). Der Beitrag endet in einer Zusammenfassung, wo auf die Relevanz der Ergebnisse hingewiesen wird (Kap. 6). Allen historiografischen Betrachtungen (Kap. 3-5) ist ein Unterkapitel zur jeweiligen methodischen und theoretischen Vorgehensweise vorangestellt, um einen Beitrag gegen die meist theorie- und methodenarme historiografische Berufsbildungsforschung zu leisten.
2 Forschungsstand
Der Forschungsstand zur beruflichen Sozialisation und politischen Bildung in Deutschland ist vielseitig. Es gibt zahlreiche Beiträge, die sich mit unterschiedlichen Aspekten der beruflichen Sozialisation befassen, wie z. B. mit der Professionalität der Ausbilder, der beruflichen Identität von Jugendlichen oder der schulischen Vorbereitung auf die Sozialisation im Betrieb (z. B. Neuenschwander/Gerber 2014; Schröter/Eckert 2014; Richter/Jahn 2015). Für die theoretische Fundierung beruflicher Sozialisation in der betrieblichen Ausbildung und Arbeit gibt es in der Berufsbildung mehrere Theorien, die sich größtenteils auf theoretische Ansätze aus der Psychologie, Soziologie und Sozialpsychologie beziehen[7] (vgl. Heinz 1995, 47ff.; vgl. Lempert 2002, 32ff.). Darüber hinaus gibt es unterschiedliche Studien (Längsschnittstudien, Fragebogenstudien usw.), die das Thema empirisch untersuchen.
Auch die politischen Einstellungen und Betätigungen von jungen Menschen sind ein Gegenstand von besonderem gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Interesse, was nicht nur die jährlich erscheinenden Shell-Jugendstudien oder der DJI-Jugendsurvey widerspiegeln. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an Einzelveröffentlichungen zum politischen Interesse und der politischen Einstellung Jugendlicher[8], die in der Gesamtzahl betrachtet, eine überschaubare Anzahl an (regelmäßigen) Studien und Untersuchungen zur politischen Einstellung Jugendlicher in Deutschland repräsentieren.
Auffallend bei der Vielzahl der Publikationen zur politischen Bildung ist allerdings, dass es kaum Untersuchungen zur politischen Bildung Jugendlicher in der Berufsbildung gibt. Vielmehr wird deutlich, dass die (Wechsel)Beziehungen politischer und beruflicher Bildung bis heute ein eher vernachlässigtes bildungswissenschaftliches Forschungsfeld darstellen (vgl. Besand 2014, 25). Das betrifft sowohl das Verhältnis politischer Bildung mit betrieblicher sowie schulischer Berufsbildung. Die Möglichkeiten und Chancen politischer Bildung in der betrieblichen Berufsbildung sind nach Zedler (2007) mitunter nicht ganz ausgeschöpft bzw. fehlt es hier an (betrieblicher) Verbindlichkeit, Förderung und Kontrolle, womit das Potenzial (und auch die Risiken) des betrieblichen Lernortes in Bezug auf politische Bildung weitestgehend unbeleuchtet bleiben (vgl. Zedler 2007).
Hervorzuheben ist, dass es insgesamt betrachtet nicht an thematischen Auseinandersetzungen mit politischer Bildung im berufsschulischen Lernort mangelt, sondern dass das Verhältnis politischer und beruflicher Bildung – insbesondere der betrieblichen Bildung – in Deutschland „bis heute zu den notorisch vernachlässigten Gegenstandsfeldern gehört“ (Besand 2014, 25). Die (didaktischen) Entwicklungslinien zu diesem Verhältnis nach dem zweiten Weltkrieg werden zwar bspw. von Weinbrenner (1992) nachgezeichnet. Aber es wird auch seiner Ansicht nach deutlich, dass die politische Bildung selbst in der beruflichen (Schul-)Praxis nicht die Bedeutung erhält, die ihr zusteht[9] (vgl. Weinbrenner 1989, 1992). So gibt es keine Untersuchungen zu Stellungnahmen des beruflichen Bildungspersonals (Lehrer, Schulleiter, Ausbilder usw.) hinsichtlich ihrer Einschätzung zur politischen Bildung am Lernort und keine objektivierten Leistungsmessungen (Input-Output-Analysen) zum Thema der politischen Bildung (vgl. Zedler 2007).
Ein Defizit an Forschungsarbeiten zur beruflichen Sozialisation und politischer Bildung in der betrieblichen Ausbildung besteht auch aus historiografischer Sicht. In Bezug auf den ausgewählten Zeitraum des Nationalsozialismus liegen kaum Untersuchungen zur betrieblichen Ausbildung vor. Zu den wenigen Publikationen zählen bspw. die im Böhlau-Verlag erschienenen Quellen und Dokumente zur betrieblichen Berufsbildung 1918-1945 (vgl. Pätzold 1980), die Studien von Kipp und Miller-Kipp (1995), die auf die industrielle Berufsausbildung und die Facharbeiterausbildung bei VW im Nationalsozialismus eingehen sowie die Dissertation von Lepold (1998) mit dem Titel „Der gelenkte Lehrling. Industrielle Berufsausbildung von 1933-1939“. Weiterhin mangelt es im thematischen Zusammenhang an Untersuchungen zur Ausbildung der Ausbilder im Nationalsozialismus und zum „Leistungskampf der Betriebe“ (vgl. Kipp/Miller-Kipp 1995, 303), wo von einer beruflichen Sozialisation und politischen Bildung erstmals ausgegangen werden kann.
Die kursorische Darstellung des Forschungsstandes zur Thematik hat verdeutlicht, dass auf eine Vielzahl an Beiträgen von unterschiedlichen Autoren zur beruflichen Sozialisation und zur politischen Bildung von Jugendlichen in der Berufsbildung zurückgegriffen werden kann. Die Fokussierung der Beiträge auf die betriebliche Bildung fällt hingegen – insbesondere für die politische Bildung – verhaltener aus. Überdies liegen kaum Untersuchungsergebnisse zur beruflichen Sozialisation und politischen Bildung in der betrieblichen Berufsbildung und Arbeit während der nationalsozialistischen Diktatur vor, obwohl gerade historiografische Arbeiten zu dieser Thematik sowohl eine Sensibilisierung für die gesellschaftlich-politische Relevanz politischer Bildung von Jugendlichen darstellen als auch eine Orientierungs- und Verstehenshilfe für aktuelle Problemlagen beruflicher Sozialisation und politischer Bildung in der Berufsbildung bieten.
Unter Berücksichtigung des dargestellten Forschungsstandes zur Thematik greift der vorliegende Beitrag die wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Gebundenheit der NS-Ideologie und damit die Konstituierung und Reproduktion nationalsozialistischer Interessen in der betrieblichen Bildung auf. Die folgenden Kapitel haben das Ziel, einerseits die Verflochtenheit wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher (Handwerks)Entwicklungen während der NS-Diktatur in der betrieblichen Bildung mit politischen Interessen und Steuerungsregimen darzustellen, andererseits soll gleichzeitig gezeigt werden, dass die betriebliche Bildung ihrerseits nationalsozialistische Interessenkonstellationen, Zielsetzungen und Ideologien reproduziert hat.
3 Sozial- und regionalhistoriografische Untersuchung des Handwerks[10]
3.1 Methodische und theoretische Vorüberlegungen
Eine Auseinandersetzung mit dem Thema der beruflichen Sozialisation und der politischen Bildung in der betrieblichen (Handwerks)Bildung im Nationalsozialismus kann unterschiedlich erfolgen. Um den Einfluss und die Relevanz der beruflichen Sozialisation und der politischen Bildung im Handwerk (in Hamburg) während der nationalsozialistischen Diktatur zu verstehen, ist es zunächst notwendig, die Sozial- und Regionalhistoriografie des Handwerks im Nationalsozialismus (in Hamburg) abzubilden. Wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Prozesse werden in Bezug zur handwerklichen und betrieblichen Berufsbildung gestellt, mit dem Ziel die Veränderungen dieser Ereignisse im Zeitraum der nationalsozialistischen Diktatur nachzuzeichnen und die Entstehungs- und Handlungszusammenhänge in Bezug zueinander zu setzen sowie die Auswirkungen auf die betriebliche (Handwerks)Bildung zu analysieren. Ferner geht es darum, den Einfluss nationalsozialistischer Vorstellungen und Interessen in der betrieblichen Bildung zu verstehen und die bisherige Forschung zur betrieblichen Berufsbildung während der nationalsozialistischen Diktatur zu erweitern.
Die regionalspezifische Betrachtung ermöglicht es zusätzlich auf Besonderheiten der betrieblichen (Handwerks)Bildung einzugehen und wirtschaftliche sowie gesellschaftliche Entwicklungen und Auswirkungen für Hamburg gezielter in Verbindung zu setzen und deren Bedeutung in Bezug auf die berufliche Sozialisation und politische Bildung zu analysieren.
Es kann festgehalten werden, dass die sozial- und regionalhistoriografischen Betrachtungen zunächst eine aufklärerische Funktion haben, eine kritisch-historische Auseinandersetzung erfolgt erst mit der Ideologiekritik. So geht es in den folgenden Rekonstruktionen nicht nur um das was – also was sich wirtschaftlich, gesellschaftlich und politisch im Nationalsozialismus verändert hat –, sondern auch um das wie und warum, was ohne eine kritische Auseinandersetzung und Reflexion der Wechselbeziehungen nicht möglich ist (vgl. Büchter/Kipp/Weise 2000, 515f.). Die Sozial-, Regional- und Ideenhistoriografie stehen sich somit in der Interpretation nicht gegenüber, sondern bedingen sich gegenseitig, weswegen sie sich kaum oder schwer voneinander definieren lassen (vgl. ebd.; Baabe-Meijer 2006, 36).
3.2 Wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Entwicklungen im Handwerk
In diesem Kapitel geht es auf der einen Seite darum, einige[11] wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Entwicklungen im Handwerk in Deutschland und Hamburg zu rekonstruieren. Es wird auf die Neuordnung des Handwerks – auf das sogenannte „Gesetz über den vorläufigen Aufbau des deutschen Handwerks“ (1933), auf die zweite und dritte Verordnung zum Gesetz (1935) und auf die „Verordnung über die Durchführung des Vierjahresplanes“ im Handwerk kursorisch eingegangen; da sie z. T. Veränderungen mit sich brachten, die den Nationalsozialisten Handlungsspielraum für gezielte Propaganda sowie Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten boten. Auf der anderen Seite soll durch die Rekonstruktionen die Frage nach der Umsetzung und Wirksamkeit der NS-Ideologie bzw. nationalsozialistischer Interessen beantworten werden.
Im Rahmen der Gleichschaltungsbestrebungen in ganz Deutschland nach Beginn der nationalsozialistischen Diktatur begannen die Nationalsozialisten auch mit der Neuordnung des Handwerks (vgl. Pätzold 1989, 269). Wie in vielen anderen Organisationen in Deutschland wurden in allen Bereichen des Handwerks Führungspositionen durch NS-Parteimitglieder ersetzt oder sie traten selbst der nationalsozialistischen Arbeiterpartei (NSDAP) bei (vgl. Wernet 1963, 208). Auch das Handwerk im liberal geprägten Hamburg musste sich unter den Gehorsam der Nationalsozialisten stellen und wurde „gleichgeschaltet“ (vgl. HWK Hamburg 1973, 81). In deutschen Städten vollzog sich die Gleichschaltung zwar unterschiedlich, das Ziel, eine neue nationalsozialistische Führungsebene nach wenigen Tagen durchzusetzen, war allerdings überall gleich (vgl. Chesi 1966, 32).
Mit der Gründung eines eigenen Dachverbands, dem „Reichsstand des deutschen Handwerks“ im Mai 1933, der alle Körperschaften und Verbände des Handwerks umfasste, wurde den Nationalsozialisten die Möglichkeit gegeben, alle Mitglieder im nationalsozialistischen Sinne zu erziehen (vgl. Wernet 1963, 208; vgl. Chesi 1966, 35f.; vgl. ZDH o. J., 4f.). Das „Gesetz über den vorläufigen Aufbau des deutschen Handwerkes“ vom 29. November 1933 bildete die gesetzliche Grundlage zur Umorganisation des Handwerks (vgl. Gewande 2007, 3) und „schuf den Rahmen für die gesamte Handwerkgesetzgebung der nationalsozialistischen Zeit“ (Chesi 1966, 42). Das Gesetz bzw. die erste Verordnung vom 15. Juni 1934 zwang alle Handwerker nicht nur den neu entstandenen Pflichtinnungen beizutreten, um eine bessere Kontroll- und Lenkmöglichkeit des gesamten Handwerks zu erhalten, sondern es gestattete auch die Einrichtung von sogenannten „Ehrengerichten“. Diese dienten zur Anklage von Handwerkern, die bspw. die Standesehre verletzt hatten oder gegen den „Gemeingeist“ verstießen[12] (vgl. „Erste Verordnung …“ 1934).
Um weitere Umorganisationen des Handwerks zu ermöglichen, wurden zeitnah gesetzliche Regelungen umgesetzt, die ganz den nationalsozialistischen Vorstellungen entsprachen (vgl. Chesi 1966, 38). Hierfür wurde z. T. auf bereits bestehende Gesetzesentwürfe bzw. alte handwerkspolitische Forderungen aus dem Kaiserreich zurückgegriffen, die allerdings gezielt nationalsozialistisch inszeniert worden sind (vgl. ZDH o. J., 5). So führte die „zweite Verordnung über den vorläufigen Aufbau des deutschen Handwerks“ vom 18. Januar 1935 den „Führergrundsatz“ ein, der die Aufsicht der Handwerkskammern dem „Reichswirtschaftsministerium“ übergab und somit die Handlungsmöglichkeiten und Eigenständigkeiten der Kammern stark begrenzte (vgl. Chesi 1966, 45f.; vgl. Knoblich 1976, 16), im Gegenzug aber auch eine Systematisierung bzw. Organisation des Handwerks bedeutete. Die noch am selben Tag erlassene dritte Verordnung war für das Handwerk von größerer Relevanz, denn sie schrieb u. a. den „großen Befähigungsnachweis“[13] vor und bildete für die Nachkriegszeit die gesetzliche Grundlage der verschiedenen Handwerksverordnungen[14]. Deswegen wird sie auch häufig als „Magna Charta des Handwerks“ bezeichnet (vgl. Chesi 1966, 46f.). Die Bedeutung dieses Gesetzes ist auch in den Hamburgischen Tageszeitungen – drei Jahre nach Einführung – erneut nationalsozialistisch herausgestellt bzw. inszeniert worden. So heißt es in einem Artikel des „Völkischen Beobachters“ vom 29. November 1936:
„Organisationen sind für den Nationalsozialismus niemals Selbstzweck, sondern immer Mittel zum Zweck gewesen. Diesen Sinn hatte auch das ‚Gesetz über den vorläufigen Aufbau des deutschen Handwerks’, das am 29. November 1933 verkündet wurde, das also heute drei Jahre in Kraft ist. […] Die nationalsozialistische Bewegung hat dem Handwerk eine so tatkräftige Förderung angedeihen lassen, weil es von ihm einen neuen Auftrieb des wirtschaftlichen und vor allem auch des kulturellen Schaffens erwartet und weil darüber hinaus im Handwerk das Leistungsprinzip am ehesten verwirklicht werden kann. Eine gesunde Mischung von Klein-, Mittel-, und Großbetrieben gehört nicht nur zu einer gesunden Volkswirtschaft, sondern bietet zahlreichen befähigten Volksgenossen Möglichkeiten des Aufstieges. Der Nationalsozialismus hat hierfür den Weg frei gemacht“ (o. A. 1936, in StaHH 135-1-I-VI-7354).
Der Einfluss und die damit zusammenhängenden Überwachungsmöglichkeiten der nationalsozialistischen Diktatur werden insbesondere in den Kriegsvorbereitungen und der -durchführung am Bsp. der „Verordnung über die Durchführung des Vierjahresplanes“ im Handwerk deutlich. Zunächst beschloss Adolf Hitler, dass sich die Kriegsvorbereitungen auf die Industrie beschränken sollten, das Handwerk hatte für die nationalsozialistische Diktatur kaum eine kriegswirtschaftliche Bedeutung, sodass sich die Bemühungen des Staates um das Handwerk – den „Primaten der Rüstungsindustrie“ (Winkler 1972, 185) – verringerten. (Vgl. Chesi 1966, 113) So sah die „Verordnung über die Durchführung des Vierjahresplanes“ vom Februar 1939 vor, dass eine Bewahrung des einzelnen Handwerks nur vom volks- und kriegswirtschaftlichem Nutzen abhänge, kriegsunwichtige und überbesetzte Handwerkszweige mussten fortan ihre Betriebe schließen (vgl. Knoblich 1976, 17). In Hamburg lässt sich für diesen Zeitraum eine Abnahme der Betriebe im Handwerk feststellen. Viele handwerkliche Arbeiter haben aufgrund des erhöhten Bedarfs in der Industrie und der dortigen besseren Bezahlung ihre Arbeitstätigkeit gewechselt (vgl. StaHH 135-1-I-VI-7354). Trotz der kriegswichtigeren Bedeutung der Industrie für die Nationalsozialisten lässt sich anhand hamburgischer Tageszeitungen zeigen, dass sich die nationalsozialistische Propaganda während der Kriegsjahre auch auf das Handwerk bezog und so weiterhin ihre nationalsozialistische Ideologie verbreitete, was folgender Artikel widerspiegelt:
„Im Jahre 1941 ist auch der letzte hamburgische Handwerksbetrieb zur Lösung von Kriegsaufgaben herangezogen worden, zu hundert Prozent vor allem das eisen- und holzbearbeitende Handwerk. […] Das Gebot der Stunde sei: Mehr arbeiten und gehorchen als angeben und reden! Disziplin ist besser, als individualistische Freiheit, die im Bolschewismus endet. Wir wollen alle stolz sein, an der Gestaltung dieser Zeit mitarbeiten zu können. Wir alle haben keinen größeren Ehrgeiz, als daß die Geschichte einmal von uns sagen kann: Sie haben gekämpft und gearbeitet – nicht für sich, sondern für Deutschland!“ (o. A. 1942, in StaHH 135-1-I-VI-7354; Herv. i. Orig.).
Die sozial- und regionalhistoriografischen Rekonstruktionen zeigen auf der einen Seite, dass während der nationalsozialistischen Diktatur viele alte Forderungen des Handwerks erfüllt worden sind, die zuvor in der Weimarer Republik von der Regierung abgelehnt wurden. Auf der anderen Seite beschränkten die neuen Vorschriften während des Nationalsozialismus die Selbstständigkeit und -verwaltung des Handwerks. Die Handlungsmöglichkeiten der einzelnen Handwerker wurden durch die verschiedenen Verordnungen stark eingeschränkt bzw. ließen ihnen nur eine Richtung frei – sich den politischen Gegebenheiten und der nationalsozialistischen Diktatur sowie der nationalsozialistischen Kontrolle anzupassen. Was die Konstituierung und Reproduktion nationalsozialistischer Interessen durch gesetzliche Verordnungen und Gleichschaltungsbestrebungen für den einzelnen (handwerklichen) Betrieb und die (Handwerks)Bildung generell bedeutete und welche ideologischen Formen und Funktionen damit verbunden waren, wird im Folgenden betrachtet.
4 Ideologiekritische Betrachtung der NS-Ideologie
4.1 Methodische und theoretische Vorüberlegungen
In dem vorliegenden historiografischen Beitrag geht es nicht nur um die Darstellung und Analyse der wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Prozesse und deren Wechselbeziehungen zur betrieblichen (Handwerks)Bildung sowie den Einfluss auf die berufliche Sozialisation und die politische Bildung, sondern es geht um das Wie und Warum – um die kritische Auseinandersetzung und Reflexion dieser Beziehungen.
Auch wenn in der historiografischen Berufsbildungsforschung ein ideologiekritisches Selbstverständnis – trotz der realistischen Wende Ende der 1960er [15]– vorliegt, werden Strukturen, Prozesse und Funktionen betrieblicher Bildung meist ahistorisiert und sind auch, wie zuvor beschriebenen, in der historiografischen Berufsbildungsforschung eher ein marginales Thema. Es erscheint somit unabdingbar, die nationalsozialistischen Interessen und die nationalsozialistische Ideologie in der betrieblichen (Handwerks)Bildung (in Hamburg) kritisch historiografisch zu rekonstruieren und ihren Gehalt in Bezug auf die berufliche Sozialisation und politische Bildung zu analysieren. Die gewählte ideologiekritische Betrachtungsweise lässt sich der kritisch-emanzipatorischen Berufsbildung zuordnen, wo die Aufklärung über den wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Entwicklungskontext des Nationalsozialismus im Vordergrund steht – verbunden mit dem Ziel der kritisch-politischen Bildung. Es geht darum, die wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Verflechtungen aller in der betrieblichen Bildung vorfindbaren Phänomene während der NS-Diktatur ideologiekritisch zu untersuchen, um nicht nur die Konstituierung nationalsozialistischer Interessen und Steuerungsregime aufzudecken, sondern auch um auf die betriebliche Reproduktion dieser Interessenkonstellationen – in Form von beruflicher Sozialisation und politischer Bildung – aufmerksam zu machen.
Damit einher geht das Politikverständnis dieser Arbeit, welches sich ebenfalls als ein emanzipatorisches versteht und eine kritische Analyse der Herrschaftsstrukturen und Gesellschaftskritik beinhaltet, um aufzuzeigen, dass es der Politik im Nationalsozialismus darum ging, sozialökonomische und wirtschaftliche Interessen und Ziele zu verwirklichen.
Vor dem Hintergrund dieses wissenschaftstheoretischen Anspruches kritisch-emanzipatorischer Berufsbildung wird in diesem Beitrag Ideologie als ein an die Gesellschaft gebundener Diskurs verstanden, der die Interessen bestimmter gesellschaftlicher Gruppen beschreibt und sich durch einen bestimmten ideologischen Sprachgebrauch kenntlich zeigen kann und somit (quellenbasiert) analysierbar ist. Um herauszufinden, wie und warum sich die NS-Ideologie auf die berufliche Sozialisation und politische Bildung in der betrieblichen (Handwerks)Bildung ausgewirkt hat, ist es zunächst notwendig, die unterschiedlichen Formen und Funktionen der nationalsozialistischen Ideologie auszudifferenzieren, um anhand dieser Kennzeichen die betriebliche Bildung im Nationalsozialismus systematisch zu untersuchen (Kap. 5).
4.2 Formen und Funktionen der nationalsozialistischen Ideologie
Ideologien sind keinesfalls als Illusionen zu betrachten, sondern haben unterschiedliche Bedeutungen und betreffen unterschiedliche Bereiche – Religion, Bildung, Wissenschaft, Politik usw. (vgl. Lemberg 1971). Der Ideologiediskurs der Wissenssoziologie und der Kritischen Theorie seit den 1960/-70er Jahren verdeutlicht zudem, dass Ideologien gesellschaftliche Werte und menschliche Bedürfnisse wie z. B. das der Gemeinschaft aufgreifen, um ihre Wirkung entfalten zu können. Dieser Bezug wird allerdings ideologisch verfremdet und dementsprechend interpretiert (vgl. Adorno 1967; vgl. Lemberg 1971; vgl. Boudon 1988). Welche Verzerrungen bzw. Formen ideologischer Betrachtungen im Nationalsozialismus wirksam waren und welche Funktionen – nationalsozialistischen Interessen und Ziele – diese Formen verfolgten, soll in den folgenden Unterkapiteln kurz angerissen werden[16], um anschließend mit den Ergebnissen exemplarisch näher auf die Konstituierung und Reproduktion nationalsozialistischer Interessen in der betrieblichen (Handwerks)Bildung in Hamburg eingehen zu können (Kap. 5).
Für die Darstellung der Formen und Funktionen der nationalsozialistischen Ideologie wird auf die Arbeiten des Politologen Kurt Lenk (1971) und des Historikers und Soziologen Eugen Lemberg (1971) zurückgegriffen, die sich in ihren Texten mit dem Wandel, der Klassifizierung und der Funktionsart von politischen Ideologien auseinandersetzten.
4.2.1 Formen politischer Ideologien
Nach Kurt Lenk (1971) existieren vier Formen politischer Ideologien mit unterschiedlichen Variationsmöglichkeiten. Die Rechtsfertigungs-, Komplementär-, Verschleierungs- und Ausdrucksideologie.
Die Rechtfertigungsideologie stabilisiert z. B. gesellschaftliche Verhältnisse, indem Vorstellungen als gesamtgesellschaftliche Interessen ideologisiert werden, was wiederum Macht- und Herrschaftsansprüche bestimmter Gruppen rechtfertigt (vgl. Lenk 1971, 24f.). So wurden im Nationalsozialismus die Vorstellungen der Machtinhaber wie bspw. die Bedrohung Deutschlands durch die Juden als gesamtgesellschaftliche Vorstellungen ausgegeben, und auch die Notwendigkeit der Gleichschaltung aller Institutionen in Deutschland wurde der Bevölkerung als gesamtgesellschaftliches Ziel propagiert, diente allerdings lediglich der Stabilisierung und Rechtfertigung der eigenen nationalsozialistischen Herrschaftsansprüche.
Im Gegensatz zur Rechtsfertigungsideologie legitimiert die zweite Form der politischen Ideologien – die Komplementärideologie – keine gesellschaftlichen Vorstellungen, sie verursacht vielmehr eine Art Ersatzwelt bzw. Idealwelt. In einer Gesellschaft, wo kaum Handlungsmöglichkeiten bestehen gesellschaftliche Verhältnisse zu verändern, nutzen Machtinhaber die Zeugung einer fiktiven Welt als eine Art Selbsttäuschung der Gesellschaftsmitglieder, um sie weiterhin für ihre (politischen) Interessen zu begeistern. (Vgl. Lenk 1971, 26ff.) Dieser Ideologietyp wurde im Nationalsozialismus besonders in schwierigen Zeiten wie dem Kriegsausbruch 1939 genutzt, um die Bereitschaft und das Verständnis der Gesellschaft für den Kriegseinsatz zu erhöhen. So wurde der Bevölkerung stets eine neue „glorreichere“ Zukunft angepriesen, für die es sich lohnen würde, jetzt auf einiges zu verzichten und einige Opfer zu erbringen.
Um eventuell aufsteigende Kritik – gerade in Krisenzeiten – an der Politik der Machtinhaber zu unterdrücken, wird auf die sogenannte Verschleierungsideologie zurückgegriffen. Hierbei wird ein Agressionsobjekt (z. B. eine Randgruppe der Gesellschaft) fixiert, um jegliche Kritik an bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen zu unterdrücken oder umzuleiten. (Vgl. Lenk 1971, 30f.) Bei der Verschleierungsideologie im Nationalsozialismus wurden z. B. Juden als Ursache und Bedrohung für alle Probleme im gesellschaftlichen System verantwortlich gemacht, um jede kritische Auseinandersetzung an bestehenden gesellschaftlichen Strukturen und Veränderungen z. B. Gleichschaltungen zu vermeiden.
Die letzte Form politischer Ideologien – die Ausdrucksideologie – ist eine Mischung unterschiedlicher Formen politischer Ideologien. Mythen und Glaubenssätze verhindern hier eine sachliche Argumentation und werden selbst zum Argument (vgl. Lenk 1971, 31ff.). So sind im Nationalsozialismus die Begriffe „Nation“ und „Rasse“ als Glaubenssätze an die Gesellschaft vermittelt worden, sodass eine sachliche Begründung für das Hervorheben der „deutschen Nation“ und der „deutschen Rasse“ erst gar nicht notwendig erschien.
4.2.2 Funktionen politischer Ideologien
Zusätzlich zu den unterschiedlichen Formen politischer Ideologien lassen sich unterschiedliche Funktionen dieser Ideologietypen erkennen, die folgend nach Eugen Lemberg (1971) kursorisch angerissen werden. Lemberg differenziert in seinen Texten vier verschiedene Funktionen ideologischer Systeme – Ideologie mit der Funktion der Integration, der Isolation, der Gesellschaftsstrukturierung und der Sozialisation.
Ideologische Systeme haben zum einen die Möglichkeit Gruppen – durch gemeinsame Werte, Vorstellungen und Ziele – zu einem Ganzen zu integrieren und dabei von anderen Gruppen abzugrenzen (Funktion Integration). Zum anderem bedeutet dies, dass andere Gruppen isoliert werden, um die eigene Gruppe als Ganzes zu stabilisieren und als etwas Besonderes hervorzuheben (Funktion Isolation). (Vgl. Lemberg 1971, 149f.) Diese Exklusivität einer Gruppe wurde auch in der nationalsozialistischen Ideologie auf der einen Seite dazu genutzt, nationalsozialistische Werte und Vorstellungen in der deutschen Bevölkerung zu verstetigen. Auf der anderen Seite wurden „Nichtgläubige“ bzw. andere Gruppen z. B. andere „Rassen“ ausgegrenzt. Durch die integrative und zugleich abgrenzende Funktion ideologischer Systeme wird eine Gesellschaft unterdessen auch strukturiert (Funktion Gesellschaftsstrukturierung). Einige Gruppen sind als besonders angesehen, andere wiederum nicht, sodass Gesellschaftsschichten entstehen, wo ein jeder sich seine Gruppenzugehörigkeit verdienen muss bzw. ihm diese angeboren ist (vgl. Lemberg 1971, 151). Dies wird z. B. in der „Rassenzugehörigkeit“ während der nationalsozialistischen Diktatur deutlich. Die inhumane Strukturierung der Gesellschaft nach Herkunftskriterien wurde durch propagandistische Aktionen der Nationalsozialisten wie z. B. Volksverhetzung der Juden weiter verstärkt.
Lemberg (1971, 152f.) stellt außerdem fest, dass jedes großes ideologische System auch ein Norm- und Wertesystem mit sich führt, was die Gesellschaft sozialisiert und welches zum Bestandteil der Erziehung gemacht wird, wo sich die nachwachsende Generation mit dem Ideologiekonstrukt identifizieren soll (Funktion Sozialisation). Im gleichen Sinne haben auch die Nationalsozialisten ein Norm- und Wertesystem nach ihren Vorstellungen entwickelt, welches an die heranwachsende Generation in unterschiedlichen Pflichtorganisationen vermittelt werden sollte. Eine Sozialisationsinstanz junger Menschen im Nationalsozialismus, zusätzlich zur „Hitlerjugend“ oder dem „Bund deutscher Mädchen“, ist z. B. der betriebliche Lernort während der Ausbildung gewesen.
Um die unterschiedlichen Formen und Funktionen der nationalsozialistischen Ideologie im Betrieb zu untersuchen, wird sich im Folgenden auf die betriebliche (Handwerks)Bildung im Nationalsozialismus in Hamburg konzentriert, um exemplarisch die Umsetzung und Reproduktion der NS-Ideologie in dieser „Sozialisationsinstanz“ zu analysieren.
5 Betriebliche (Handwerks)Bildung im Nationalsozialismus in Hamburg
5.1 Methodische und theoretische Vorüberlegungen
Die Untersuchung nationalsozialistischer Interessen und der NS-Ideologie in Bezug auf die berufliche Sozialisation und politische Bildung in der betrieblichen (Handwerks)Bildung erfolgt exemplarisch im Spiegel von schriftlich fixiertem Material (Dokumente aus dem Staatsarchiv Hamburg). Nach Einsichtnahme in die Dokumentenlage zu dieser Thematik im Archiv ist die Materialauswahl auf die betriebliche (Handwerks)Bildung eingegrenzt worden. Um eine systematische und nachvollziehbare Auswertung der Dokumente zu erzielen, erfolgt die Darstellung und Interpretation auf die zuvor beschriebenen Formen und Funktionen der nationalsozialistischen Ideologie (Kap. 4). Dies ermöglicht es sowohl die berufliche Sozialisation als auch die politische Bildung in der betrieblichen (Handwerks)Bildung in Hamburg während der nationalsozialistischen Diktatur zu untersuchen. Angemerkt sei, dass diese Dokumentendarstellung und -interpretation nur einen Teilausschnitt der Gesamtheit aller Dokumente widerspiegelt und dass nicht von starren ideologischen Mustern ausgegangen werden kann. Politische Ideologien sind grundsätzlich wandelbar und haben sich auch während der nationalsozialistischen Diktatur verändert (z. B. von der Funktion der Stabilisierung der Gesellschaft bis hin zur Kriegsvorbereitung).
5.2 Nationalsozialistische Politisierung der betrieblichen Bildung
Mit Beginn der nationalsozialistischen Diktatur begannen auch im Handwerk die ersten Gleichschaltungsbestrebungen, die u.a. eine weltanschauliche und wirtschaftliche Schulung des (gewerblichen) Mittelstandes – ganz im nationalsozialistischen Sinn – zum Ziel hatten. Hierfür wurde Ende des Jahres 1932 bereits der „Nationalsozialistische Kampfbund für den gewerblichen Mittelstand“ von der NSDAP gegründet, um den Mittelstand an die NSDAP zu binden (vgl. StaHH 135-1 I-IV-7488). Im Zuge der Gleichschaltungen wurde dieser 1933 in die „Nationalsozialistische Handwerks-, Handels- und Gewerbeorganisation“ („NS-Hago“) hinübergeführt (vgl. Dreßen 2001, 607). „Ihr war die Aufgabe gestellt, die liberalistische Wirtschaftsauffassung zu bekämpfen und die nationalsozialistische Weltanschauung auch im sogenannten ‚Mittelstande’ durchzusetzen“ (o. A. 1935, in StaHH 135-1 I-IV-7488). Zwei Jahre später wurde diese Organisation mit der „Reichsbetriebsgemeinschaft Handwerk und Handel“ der Deutschen Arbeitsfront (DAF) zusammengelegt (vgl. StaHH 135-1 I-IV-7488; vgl. Dreßen 2001, 607). Die „Hamburger Nachrichten“ beschrieben die Auflösung der „NS-Hago“ und die neuen Aufgaben der „Reichsbetriebsgemeinschaft Handwerk und Handel“ wie folgt:
„Der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung folgend, ist das Parteiamt nunmehr zweckentsprechend umgebaut worden. Auf die NS-Hago als besondere Organisation kann verzichtet werden, da die Partei, die Betriebsgemeinschaften Handel und Handwerk der Deutschen Arbeitsfront sowie die gewerbliche Wirtschaft genügend organisatorische Möglichkeiten bietet. […] Es wird jedoch nicht auf das Amt für Handwerk und Handel der NSDAP verzichtet. Das Parteiamt bleibt bestehen. Es ist ein rein politisches Amt mit den Aufgaben:
1. die weltanschaulichen Grundsätze der NSDAP in den Vordergrund zu stellen,
2. die sozial- und wirtschaftspolitische Entwicklung in Handwerk und Handel zu beobachten und zu überwachen,
3. die zuständigen Hoheitsträger der Partei in Fragen des Handwerks und Handels zu beraten“ (o. A. 1935, in StaHH 135-1 I-IV-7488).
Anhand dieser Ergebnisse lässt sich bereits erkennen, dass mit Beginn der nationalsozialistischen Diktatur auch eine einheitliche weltanschauliche und wirtschaftliche nationalsozialistische Schulung des (gewerblichen) Mittelstandes erfolgte. Die Überwachung und die Kontrolle des Handwerks und des Handels oblagen fortan dem Aufgabenbereich der NSDAP. Laut der Tageszeitung „Völkischer Beobachter“ handelte es sich hierbei 1934 um insgesamt 1,4 Millionen handwerkliche und gewerbliche Betriebe in ganz Deutschland, die sich folgendermaßen aufteilten (vgl. o. A. 1934, in StaHH 135-1 I-IV-7488) (Tab. 1).
Tabelle 1: Betriebsaufteilung nach Gruppen (o. A. 1934, in StaHH 135-1 I-IV-7488)
|
Bekleidung, Reinigung einschließl. Friseure |
500 000 |
35% |
|
Nahrungs.- und Genußmittel |
230 000 |
16% |
|
Bauhandwerk und Baunebengewerbe |
200 000 |
14% |
|
Holzverarbeitung, Spielwaren usw. |
180 000 |
13% |
|
Metallverarbeitung |
190 000 |
15% |
|
Lederverarbeitung |
30 000 |
2% |
|
Papierherstellung u. Verarbeitung |
30 000 |
2% |
|
Textilien und sonstige Handwerke |
40 000 |
3% |
|
Handwerk insgesamt: |
1 400 000 |
100% |
Die meisten Handwerksbetriebe waren laut dem Zeitungsbericht Klein- und Mittelbetriebe, fast 94% dieser Handwerkswerkbetriebe waren Kleinbetriebe mit bis zu drei Gesellen[17] – Großbetriebe waren in der Minderheit (vgl. o. A. 1934, in StaHH 135-1 I-IV-7488).
Eine Berufsausbildung fand somit größtenteils in kleinen Handwerksbetrieben im Nationalsozialismus statt und die betriebliche Bildung der Lehrlinge genoss während der nationalsozialistischen Diktatur eine besondere Stellung im Gegensatz zur schulischen. Der Leiter des Amtes für Berufserziehung und Betriebsführung der DAF, Karl Arnold, bezeichnete die Lehre als weltanschauliche Erziehungsmöglichkeit, die im Vordergrund vor der Schule stand (vgl. Arnold 1938, in StaHH 614-2/5 A13). Der Betrieb, als Träger dieser Berufserziehung, sollte die nationalsozialistische Erziehung mit umsetzen. Hierzu waren vor allem die Lehrmeister und Ausbilder, die sogenannten „Männer der Praxis“, die täglich mit den „jungen, zu formenden Menschen“ Kontakt haben verantwortlich (vgl. Arnold 1938, in StaHH 614-2/5 A13).
Arnold hob in einem Artikel der Zeitschrift „Arbeitertum. Amtliches Organ der Deutschen Arbeitsfront einschl. NS-Gemeinschaft ‚Kraft durch Freude’“ in Bezug auf den „Internationalen Kongress für berufliches Bildungswesen“[18] in Berlin vor, dass die deutsche Berufserziehung
„von jeher, besonders aber seit der nationalsozialistischen Revolution, eigene Wege gegangen [ist]. Der Unterschied zwischen Deutschland und dem Ausland auf diesem Gebiet ist dadurch gekennzeichnet, daß die deutsche Berufserziehung sich nicht im Berufs- und Fachschulwesen erschöpft, sondern sich weitgehend auf der Werkstatt und ihren lebensformenden Kräften aufbaut. Die deutsche Berufserziehung sieht in der Lehrwerkstatt, also in der Lehre überhaupt, Kern- und Mittelpunkt ihrer Betätigung. […] Unsere Berufserziehung sieht ihr Ideal in der grundsätzlichen Einheit von Erziehung und Schulung. Sie erzieht in der Arbeit den ganzen Menschen, trennt daher auch nicht das Weltanschauliche von Fachlichen“ (Arnold 1938, in StaHH 614-2/5 A13).
Der Artikel betont die Relevanz des betrieblichen Lernortes für die gesamte Berufserziehung und setzt die Lehrwerkstatt in den Mittelpunkt. Auch die Ausstellung „Deutsche Berufserziehung“, die im Rahmen des Kongresses stattfand, betonte diese Fokussierung, denn sie ließ deutlich erkennen, dass der Schwerpunkt der beruflichen Ausbildung in und bei den Betrieben lag (vgl. Arnold 1938, in StaHH 614-2/5 A13).
Für die betriebliche (Handwerks)Bildung bzw. die deutsche Berufserziehung gab es folgende institutionelle Aufgabenverteilung (s. Tab. 2). Die oberste Entscheidungsmacht über weltanschauliche und politische Berufserziehung hatte die NSDAP, die schulische Erziehung oblag dem Aufgabenbereich des Erziehungsministeriums bzw. des Schulwesens. Für die weltanschauliche und politische Erziehung im Betrieb war die DAF bzw. der Betriebsführer des Betriebes selbst verantwortlich (vgl. Arnold 1938, in StaHH 614-2/5 A13).
Tabelle 2: Aufbau der deutschen Berufserziehung (Arnold 1938, in StaHH 614-2/5 A13)
|
NSDAP |
„Das Grundsätzliche, vor allem die schöpferische Klärung und Entscheidung im Bereiche der weltanschaulichen und politischen Erziehung, regelt die Partei“ |
|
Erziehungs-ministerium/ |
„Das eigentliche Schulwesen, als berufserzieherischer Sektor, der bereits fachlich wie pädagogisch geklärt ist, wird vom Erziehungsministerium betreut“ |
|
DAF/Betrieb |
„Die Deutsche Arbeitsfront sieht nun im Betrieb bekanntlich die lebendige Zelle der Wirtschaft und somit auch in der Lehrwerkstatt des Betriebes den Ansatzpunkt lebendiger und schöpferischer Entwicklung. Aus dieser Vorstellung heraus überträgt die DAF gewissermaßen ihre berufserzieherische Aufgabe dem Betriebsführer“ |
Nachdem die Bedeutung des betrieblichen Lernortes für die nationalsozialistische Schulung dargestellt worden ist, wird in den folgenden Unterkapiteln nicht nur die Umsetzung der NS-Ideologie in der betrieblichen (Handwerks)Bildung exemplarisch betrachtet, sondern es wird auch untersucht, wie und warum eine Umsetzung und Reproduktion der NS-Ideologie in der betrieblichen (Handwerks)Bildung erfolgte, um zu zeigen, welche nationalsozialistischen Interessen maßgeblich für diese Veränderungen waren.
5.2.1 „Leistungskampf der deutschen Betriebe“
Nach Robert Ley, dem Leiter der DAF, sollte der sogenannte „Leistungskampf der deutschen Betriebe“ die deutsche Wirtschaft zu einem einzigen nationalsozialistischen Musterbetrieb machen (vgl. Ley 1936, zit. n. Schneider 1999, 222). Aus vielen einzelnen Unternehmen sollte ein Ganzes – ein nationalsozialistischer Musterbetrieb – entstehen. Dieser Aufruf von Ley verdeutlicht die Funktion der Integration ideologischer Systeme, wonach Arbeitgeber- und -nehmer durch gemeinsame nationalsozialistische Vorstellungen zu einer Betriebsgemeinschaft integriert und aktiviert werden sollten und sich nationalsozialistisch mustergültig verhalten sollten.
Um diese Idee zu verwirklichen wurde der Betrieb zum Zentrum der Arbeit sowohl für Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer gemacht, was wiederum diesen fortan nicht nur zur reinen Arbeitsstätte machte, sondern auch zu einem Ort der Umsetzung nationalsozialistischer Norm- und Wertevorstellungen, was durch die Teilnahme an solch einem Wettkampf von den Nationalsozialisten kontrolliert werden konnte (vgl. Smelser 1988, 175). Damit hatte der Betrieb nicht nur eine sozialisierende Funktion, wo nationalsozialistische Normen und Werte an bestehende und nachwachsende Generationen weitergetragen werden sollten, sondern auch eine integrative Funktion, da sich Arbeitgeber und -nehmer während des Wettbewerbes z. B. durch gemeinsame Feierabende näher kommen sollten (vgl. Kaufmann 1937, in StaHH 135-1-IIV-7511). Dieser Umstand bot den Nationalsozialisten erneut eine Überwachungs- und Kontrollmöglichkeit der nationalsozialistischen Einstellungen der Arbeiterschaft.
Öffentlichen Einrichtungen bzw. Betrieben wie der Staatsoper und dem staatlichem Schauspielhaus in Hamburg war es zunächst verwehrt worden, sich am „Leistungskampf der deutschen Betriebe“ zu beteiligen; diese Anordnung wurde 1938 allerdings verworfen bzw. durch Ergänzungen für öffentliche Betriebe angepasst. Die vorige Kritik, dass öffentliche Betriebe bzw. deren Berufsausbildungseinrichtungen „unmittelbar oder mittelbar aus Mitteln der öffentlichen Hand“ (StaHH 131-10 II-340) erhalten werden, ist aufgehoben worden und es oblag dem jeweils zuständigen Reichsminister, ob er einzelne Betriebe vom Wettkampf ausschließen wollte (vgl. ebd.). In Hamburg erfolgte z. B. 1939 ein Aufruf an die Betriebe der Reichswasserstraßenverwaltung sich am „Leistungskampf der deutschen Betriebe“ zu beteiligen, um zu zeigen, dass die „Betriebsführer und Gefolgsschaftsmitglieder sich mit ganzem Herzen für die nationalsozialistische Weltanschauung einsetzen. […] Wie jeder Deutsche sein gesamtes Wollen und Denken darauf auszurichten hat, seine Leistung und seine Kraft für das Wohl des deutschen Volkes einzusetzen, so haben auch die Angehörigen der Reichswasserstraßenverwaltung die Pflicht, in diesem 3. Leistungskampf der deutschen Betriebe die Voraussetzungen zu erfüllen, die für den Aufschwung des deutschen Reiches maßend sind“ (ebd.).
Um am „Leistungskampf der deutschen Betriebe“ teilzunehmen und um zur Verleihung der Auszeichnung des „Nationalsozialistischen Musterbetriebes“ bzw. „Gaudiplom für hervorragende Leistungen“ zugelassen zu werden, musste zunächst ein Antrag des Betriebes an die zuständige Stelle der deutschen Arbeitsfront gestellt werden (vgl. ebd.). Die Überprüfung und Beurteilung des Betriebes erfolgte anhand der allgemeinen nationalsozialistischen Haltung, dem sozialen Anstand von Führung und Gefolgschaft, der Verwirklichung der Betriebsgemeinschaft und der Durchführung von Sicherheitsmaßnahmen (vgl. Richtlinien für den Leistungskampf der öffentlichen Betriebe, in StaHH 131-10 II-340). Die Richtlinien zur Überprüfung dieser Punkte betrafen z. B. soziale und personelle Maßnahmen und Fragen zur Eingliederung des Betriebes in die Volksgemeinschaft. Gefragt wurde bspw. „Sind die Personaldezernentenstellen bzw. die Stellen der Leiter der Personalabteilungen mit Nationalsozialisten besetzt?“, „Finden Betriebsappelle Kameradschaftsabende, kameradschaftliche Veranstaltungen und sonstige Gemeinschaftsfeiern statt?“ oder „Werden die Ziele der NSDAP, ihrer Gliederungen und angeschlossenen Verbände dadurch gefördert, daß der Gefolgschaft die Zugehörigkeit zur Werkschar, HJ, SA […] usw. seitens der Betriebsführung (Betriebsleistung) in geeigneter Form empfohlen wird?“ (StaHH 131-10 II-340).
Anhand der Betrachtungen zur Durchführung des „Leistungskampfes der deutschen Betriebe“ lässt sich erkennen, dass mehrere nationalsozialistische Interessen wie bspw. eine Kontrolle der nationalsozialistischen Einstellungen mit diesem Wettkampf verfolgt worden sind. Der Wettkampf diente außerdem dazu, die Betriebsmitglieder zu einem Ganzen zu integrieren und ermöglichte eine Kontrolle ihrer politischen Einstellungen bzw. ihrer nationalsozialistischen Norm- und Wertesysteme.
5.2.2 Einführung von Betriebsappellen
Im Auftrag des Reichswirtschaftsministeriums wurde im Jahr 1934 durch den Hamburger Senat beschlossen, dass Kontrolluhren und ähnliche Kontrolleinrichtung für die Dienst- und Arbeitszeit in allen Betrieben abzuschaffen seien. Ausnahmen von dieser Regelung benötigten fortan die Genehmigung des Senats. Statt den sonst üblichen Stechuhren sollten regelmäßige Betriebsappelle[19] die Kontrolle der Dienstzeit im Nationalsozialismus übernehmen (vgl. StaHH 131-10II-269). Des Weiteren wollte der Senat zum gegenwärtigen Zeitpunkt darüber informiert werden, in welchen (öffentlichen)[20] Betrieben bereits Betriebsappelle durchgeführt werden und wie oft und in welcher Form diese stattfinden (vgl. ebd.).
Mit Abschaffung der Stechuhren und der Einführung von Betriebsapellen werden zwei nationalsozialistische Interessen deutlich erkennbar. Zum einen ist die Ehre der Arbeiter hervorgehoben worden, indem die „entwürdigende Kontrollfunktion“ (ebd.) abgeschafft wurde und der Arbeiter als Mitglied der „Volksgemeinschaft“ aufgewertet worden ist. Zum anderen wurde durch die Einführung von Betriebsapellen eine nationalsozialistische Kontrollfunktion hergestellt, die es nicht nur ermöglichte, der gesamten Arbeiterschaft wichtige (nationalsozialistische) Informationen zugänglich zu machen, sondern diese auch politisch zu instrumentalisieren.
Der Reichsorganisationsleiter der NSDAP Robert Ley beschrieb den Sinn der Appelle in einem Artikel[21] mit folgenden Worten:
„Dieser Appell soll nicht mehr und nicht weniger sein als der ehrliche Beweis aufrichtiger Kameradschaft zwischen Betriebsführer und Gefolgschaft! Während einst die automatisch-maschinelle Stoppuhr dem lebendigen, schaffenden Menschen das niederdrückende Gefühl gab, wesensloses Nichts im Riesenverdienstapparat zu sein, so soll durch den gemeinsamen Betriebsappell die Durchführung des gesamten deutschen Volkes mit der einzelnen Betriebsgemeinschaft geschaffen werden. Aus dieser allmorgendlichen Handlung soll statt der toten, unpersönlichen, zu nichts verpflichtenden ‚Zweckmäßigkeit’ stolzes Selbstgefühl und gerechte Wertung der eigenen Leitung erwachsen. Der Betriebsappell soll ein großer Schritt vorwärts zur Gestaltung des deutschen Begriffes der Arbeit werden“ (o. A. 1934, in StaHH 131-10II-269).
Die ideologischen Funktionen in der Auseinandersetzung mit dem Begriff der Arbeit im Nationalsozialismus sind sehr unterschiedlich. Die Aufwertung der Arbeit und des Arbeiters im Nationalsozialismus, so wie auch im obigen Ausschnitt deutlich wird, diente der Strukturierung und Stabilisierung der Gesellschaft (Rechtsfertigungsform) und hatte die Funktion alle Arten der Arbeit (körperliche/geistige) gleichwertig zu behandeln und gesellschaftlich anzusehen. Die Arbeit war ein relevanter politischer Gegenstand im Nationalsozialismus, der häufig zur Propaganda und Ideologisierung eingesetzt wurde, z. B. durch die verschiedenen Aktionen des Amtes „Schönheit der Arbeit“.
Die Organisation und Durchführung der regelmäßigen Betriebsappelle gestaltete sich für hamburgische Einrichtungen recht unterschiedlich. Denn trotz der verpflichtenden Teilnahme an den Betriebsappellen, lässt sich anhand der Akten des Staatsarchives feststellen, dass viele Arbeiter den Apellen fernblieben, bspw. betraf das die Arbeiterschaft des „Schlachthof- und Viehmarkts Hamburgs“ (vgl. StaHH 377-11-140). Andere Betriebe hingegen hatten eher organisatorische Schwierigkeiten mit der regelmäßigen und verbindlichen Umsetzung solcher Appelle für alle schichtarbeitenden Menschen, so wie das Krankenhaus St. Georg in Hamburg (vgl. StaHH 131-10II-269). Auch die inhaltliche Ausgestaltung der Betriebsappelle zeigt am Bsp. des „Schlachthof- und Viehmarkts Hamburgs“, dass es während der nationalsozialistischen Diktatur thematische Unterschiede gab. Auf der einen Seite gab es (Tages)Parolen, die in den amtlichen Mitteilungen[22] der DAF verkündet worden sind und sich mit dem Sinn der Arbeit befassten bzw. nationalsozialistisch ausgerichtet waren, was folgende Parolen beweisen:
- „Am Anfang unseres Kampfes stand Deutschland, am Ende unseres Kampfes wird wiederum Deutschland stehen!“ (Adolf Hitler) (DAF 1935, in StaHH 614-2/5 A11).
- „Der Kampf um die Seele des deutschen Volkes ist mit in erster Linie auch ein Kampf für die alte deutsche Auffassung vom Wesen und Werk der Arbeit“ (Alfred Rosenberg) (DAF 1935, in StaHH 614-2/5 A11).
- „Arbeit ist das Zauberwort, Arbeit ist des Glückes Seele, Arbeit ist des Friedens Wort!“ (Heinrich Seidel) (DAF 1935, in StaHH 614-2/5 A11).
Auf der anderen Seite ging es bei den Versammlungen nicht nur um nationalsozialistische Themen, wie u. a. die Protokolle der Betriebsappelle[23] zeigen (vgl. StaHH 377-11-140). So wurde bspw. zu Beginn der nationalsozialistischen Diktatur bei den Zusammenkünften über Personalveränderungen, Termine, Sparmaßnahmen, Unfallverhütung und Unfallstatistiken gesprochen, es gab allerdings auch Informationen über Strafen bei Landesverrat (vgl. ebd.) Mit Beginn des zweiten Weltkrieges wurden andere – weitaus nationalsozialistischere Themen – aufgegriffen, die relevante ideologische Funktionen verfolgten. So sind 1939 beim Betriebsappell des „Schlacht- und Viehmarkts Hamburgs“ am 9. Dezember bspw. folgende Punkte besprochen worden:
- „Die Belegschaft hat sich besonders während der Kriegszeit durch eine vorbildliche Haltung auszuzeichnen.
- Die Einnahmen sind erheblich zurückgegangen. Es muß das Bestreben der Gefolgschaft sein, die Mindereinnahme soweit wie irgend möglich durch Einsparungen auszugleichen. […]
- Der Betriebsführer kommt abschließend auf den Krieg zu sprechen und führt aus, daß die Belegschaft stets einen gesunden Optimismus zeigen soll und gegen Miesmacher aufzutreten habe“ (StaHH 377-11-140).
Die Stärkung der Betriebsgemeinschaft stand in den ersten Kriegsjahren im Vordergrund der Aufgaben der Betriebsappelle. Es wurden vermehrt Anweisungen erteilt (vorbildliche Haltung zu zeigen, Optimismus zu bewahren usw.), die die Funktion hatten, die Belegschaft zu einem Ganzem zu integrieren, dass an den Sieg des Krieges glaubte und somit gemeinsame nationalsozialistische Interessen vertrat. Um die Arbeiterschaft nicht nur während der Betriebsappelle nationalsozialistisch zu sozialisieren und um ihnen nationalsozialistische Normen und Werte zu vermitteln, sollten sie auch für die Reden des Führers freigestellt werden bzw. sollte die Dienststelle eine Übertragung mit Lautsprechern sicherstellen und ihre Arbeiter zur Anhörung verpflichten – soweit das die Betriebsdurchführung nicht zu weit einschränkte (vgl. StaHH 377-11-238). Ebenfalls wurde die Beschaffung von Hitlers Buch „Mein Kampf“ durch den hamburgischen Senat für die Belegschaft und die Besorgung von Bildern des Führers für Diensträume im „Schlacht- und Viehmarkt“ angeordnet (vgl. ebd.).
Am Beispiel der Betriebsappelle wird nicht nur deutlich, wie die Umsetzung der nationalsozialistischen Ideologie im Betrieb erfolgte, sondern auch warum diese erfolgte (Stärkung der Betriebsgemeinschaft, Integration der Arbeiter, gemeinsame Wertevermittlung usw.) und welche nationalsozialistischen Interessen dafür maßgeblich waren – nämlich die kontrollierte Integration des Arbeiters in die Betriebsgemeinschaft bzw. „Volksgemeinschaft“.
5.2.3 Umgang mit Juden (im Handwerk)
Einher mit der Funktion der Integration in der nationalsozialistischen Ideologie geht die Funktion der Ausgrenzung. Wie und warum im Betrieb ausgegrenzt worden ist, wird im folgenden Kapitel betrachtet.
Ein gemeinsames nationalsozialistisch propagiertes Feindbild fordert politische Aktionen und so wurde zunächst am 15. September 1935 das „Reichsbürgergesetz“ verabschiedet, was die deutsche Bevölkerung in „Staatsangehörige“ und in „Reichsbürger“ einteilte. „Reichsbürger“ war nur derjenige „deutschen oder artverwandten Blutes, der durch sein Verhalten beweist, daß er gewillt ist, in Treue dem Deutschen Volk und Reich zu dienen“ („Reichsbürgergesetz“ 15.09.1935). Mit dem „Reichsbürgergesetz“ und mit den darauffolgenden Verordnungen hierzu sowie den „Nürnberger Gesetzen“ wurden die Freiheiten und Rechte der jüdischen Bevölkerung stark beeinträchtigt. Allerdings ließ sich mit Gesetzen allein, laut einem Zeitschriftenbericht, das „Judenproblem“ nicht lösen.
„Wichtiger aber ist, daß das gesamte Volk sich von diesen Schmarotzern abwendet, daß es die Fremdkörper abstößt wie ein gesunder Organismus die Bazillen, daß niemand mit dem Juden ein Geschäft tätigt und keiner mit ihm unter einem Dach wohnt. Eine gesunde antisemitische Haltung muß das ganze Volk haben, dann brauchen wir keine Gesetze, um die Parasiten loszuwerden. […] Nur wenn jeder an seinem Platz mithilft, kann das Judenproblem in Deutschland restlos und radikal gelöscht werden, dann können wir den Fremdkörper aus unserem Volke entfernen, vorher nicht, und wenn noch soviel gute Gesetze erlassen werden. Was uns noch fehlt, ist ein frischer, gesunder, antisemitischer Wind, der aber auch die entferntesten Ecken rein kehrt“ (Brüggemann 1938, in StaHH 614-2/5 A13).
Dieser „antisemitische Wind“ durchdrang auch den Lernort des Betriebes und fortan wurde neben der beruflichen Eignung auch die persönliche Anforderung sowohl der Handwerksmeister als auch der Lehrlinge in Frage gestellt. Um eine berufliche Sozialisation und politische Bildung ganz im nationalsozialistischen Sinne während der betrieblichen Ausbildung durchzuführen, schien es selbstverständlich, dass Betriebsführer bzw. Ausbilder Parteimitglieder der NSDAP waren. Zu Diskussionen kam es im Nationalsozialismus 1941 allerdings bei der Frage, ob Handwerksmeister, die mit einer jüdischen Frau verheiratet waren zur Berufsausbildung geeignet waren (vgl. o. A. 1941). In einem Dokument zur Beantwortung dieser Frage heißt es wie folgt:
„Das Ausbildungsverhältnis soll nicht nur dazu dienen, die Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln, die die mehr oder weniger vollkommene Ausübung eines bestimmten Berufes oder Handwerks ermöglichen. Es hat ebenso das Ziel, als Berufserziehungsverhältnis dazu beizutragen, daß der Jugendliche an Hand der fachlichen Ausbildung zu einer bestimmten Haltung erzogen wird, die nicht nur auf seine spätere Berufsarbeit, sondern auf seine Gesamteinstellung als Glied der deutschen Volksgemeinschaft von nicht zu unterschätzendem Einfluß ist. […]“ (ebd.).
Dadurch, dass Ausbildungsverhältnisse auch nationalsozialistische Berufserziehungsverhältnisse waren, durften Handwerksmeister, die mit einer Jüdin verheiratet waren und in fachlicher Hinsicht berechtigt wären, Lehrlinge auszubilden, diese Aufgabe nicht mehr übernehmen, da sie ihre persönliche Anforderung an ein nationalsozialistisches Vorbild verloren hatten (vgl. ebd.). Dieses Beispiel zeigt, dass das Ziel der betrieblichen (Aus)Bildung darin bestand, den Lehrlingen zusätzlich zur fachlichen Schulung und zur praktischen Eignung eine nationalsozialistische Haltung zu erziehen und ihnen ihre Position sowie Aufgabe in der „Volksgemeinschaft“ zu verdeutlichen. Die fachliche Vermittlung von Berufsinhalten stand somit hinter der Funktion der Norm- und Wertevermittlung, weil Handwerksmeister mit jüdischen Ehefrauen diese Arbeit nicht mehr erbringen durften.
Die drei Beispiele „Leistungskampf der deutschen Betriebe“, Einführung von Betriebsappellen und der Umgang mit Juden im Handwerk haben das nationalsozialistische Interesse an einer NS-orientierten beruflichen Sozialisation und politischen Bildung im Betrieb deutlich wiedergegeben. Sie erfüllten in ihrer Umsetzung unterschiedliche ideologische Funktionen (Integration, Isolation, Strukturierung und Sozialisation), die zur Manifestierung der nationalsozialistischen Ideologie 1933-1945 beigetragen haben.
Welche Relevanz diese Erkenntnisse für die gegenwärtige Berufsbildung und Berufsbildungspolitik haben, wird im abschließenden Kapitel angerissen.
6 Zusammenfassung der Ergebnisse
Wie der Beitrag zeigen konnte, sind Betriebe nicht nur relevante (Bildungs)Institutionen in einer Gesellschaft, die eine (Aus)Bildungsfunktion für junge Menschen haben, sondern das (ausbildende) Personal im Betrieb hat auch die Pflicht Jugendliche charakterlich zu fördern (vgl. BBiG §14). Darüber hinaus sind Betriebe Stätten beruflicher Sozialisationsprozesse und haben Potenzial für (arbeits- und berufsbezogene) politische Bildung im Ausbildungsalltag. Jenseits dieser Bedeutungsebenen kann der betriebliche Lernort – wie die exemplarische Betrachtung des Nationalsozialismus gezeigt hat – als (politisches) Herrschaftsinstrument missbraucht werden.
Nationalsozialistische Entwicklungen haben nicht nur die curricularen Ausrichtungen im Betrieb verändert, sondern hatten auch Einfluss auf die berufliche Sozialisation und politische Bildung, sodass diese zur Produktion bzw. Weitergabe der nationalsozialistischen Ideologie beigetragen haben. Die berufliche Sozialisation und die politische Bildung im Betrieb haben politische Interessen verfolgt und dienten der Stabilisierung der betrieblichen Herrschaft, sie konnten die Subjekte ideologisch vereinnahmen und machten betriebliche Bildung zu einem Interessenkonstrukt der Politik. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu betonen, dass sich nicht jeder Betrieb bzw. jede Person ideologisieren ließ und/oder ideologisierte. Die NS-Ideologie sollte den Betrieb und die hier handelnden Personen zwar ideologisch durchdringen bzw. beeinflussen, d. h. die Denk-, Haltungs- und Handlungsweise bestimmen, ob und inwieweit jemand ideologisiert worden ist, lässt sich jedoch nicht immer an bestimmten Merkmalen (z. B. Ausführung des Hitlergrußes) ausmachen. Hervorzuheben sind auch die Widerstandaktionen gegen den Nationalsozialismus, wie z. B. durch unterschiedliche Parteien und Verbände der Arbeiterbewegungen in Hamburg[24]
Zusammengefasst wird deutlich, dass das ideologische Potenzial des betrieblichen Lernortes nicht zu unterschätzen ist und dementsprechend sollte in der Berufsausbildung m. E. eine Vergegenwärtigung bzw. Sensibilisierung für das Thema der Ideologisierung in Form einer kritisch-politischen Bildung stattfinden, wo es darum geht, Jugendlichen bewusst zu machen, dass sie selbst im beruflichen und individuellen Handeln in Macht- und Herrschaftsverhältnisse eingebunden sind. Sodass sie reale Herrschaftsverhältnisse ideologiekritisch reflektieren können, sich über eigene und andere Interessen bewusst werden und (politische) Durchsetzungsstrategien erkennen.
Die Ergebnisse dieses Beitrages stellen zwar auf der einen Seite die gesellschaftlich-politische Relevanz der kritisch-politischen Bildung für die Überwindung totalitären antidemokratischen Denkens, Urteilen und Handelns heraus. Auf der anderen Seite wird allerdings auch deutlich, dass das Thema im Diskussions- und Forschungsfeld der Berufs- und Wirtschaftspädagogik eher vernachlässigt behandelt wird. Was wissen wir schon darüber, wie Bildungsziele in Hinblick auf kritisch-politische Bildung in der Berufsausbildung insbesondere im Betrieb erreicht werden und wie diese von den Akteuren der Berufsbildung wahrgenommen werden?
Was wir wissen, ist, dass die Tendenz in der Forschung zur Ahistorisierung zugunsten von messbaren Konstruktionen geht, obwohl gerade die heutigen komplexen Prozesse in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft m. E. eine kritisch-politische Bildung unterschiedlicher Nuancen[25] erfordern würden.
Literatur
Adorno, T.W. (1967): Jargon der Eigentlichkeit. Zur deutschen Ideologie. Berlin.
Aff, J./Klusmeyer, J./Wittwer, W. (2010): Berufsausbildung in Schule und Betrieb. In: Nickolaus, R. et al. (Hrsg.): Handbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Stuttgart, 330-336.
Arnold, K. (1938): Deutsche Berufserziehung vor den Augen der Welt. In: Arbeitertum. Amtliches Organ der Deutschen Arbeitsfront einschl. NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude“. 8. Jg., 11 Folge. Berlin, 3-4. In: StaHH 614-2/5 A13 „Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) Gau Hamburg. ‚Arbeitertum’, Amtliches Organ der Deutschen Arbeitsfront einschließlich NS-Gemeinschaft ‚Kraft durch Freude’“.
Arnold, R. (1983): Pädagogische Professionalisierung betrieblicher Bildungsarbeit. Explorative Studie zur Ermittlung weiterbildungsrelevanter Deutungsmuster des betrieblichen Bildungspersonals. Frankfurt a.M. u.a.
Baabe-Meijer, S. (2006): Berufliche Bildung am Bauhaus: die Lehre am historischen Bauhaus und daraus resultierende Entwicklungsperspektiven für berufspädagogisch-didaktische Arbeit im Berufsfeld Farbtechnik und Raumgestaltung. Paderborn.
Berufsbildungsgesetz (BBiG). Online: https://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/__14.html (20-03-2017).
Besand, A. (2014): Monitor. Politische Bildung an beruflichen Schulen. Probleme und Perspektiven. Schwalbach.
Boudon, R. (1988): Ideologie. Geschichte und Kritik eines Begriffs. Reinbek bei Hamburg.
Brüggemann, A. (1938): Keiner will Sie haben. Die Pleite der Judenkonferenz in Evian. In: Arbeitertum. Amtliches Organ der Deutschen Arbeitsfront einschl. NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude“. 8. Jg., 11 Folge. Berlin, 19. In: StaHH 614-2/5 A13 „Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) Gau Hamburg. ‚Arbeitertum’, Amtliches Organ der Deutschen Arbeitsfront einschließlich NS-Gemeinschaft ‚Kraft durch Freude’“.
Büchter, K. (2015): Berufsbildung im Betrieb – zur historischen Entwicklung von Steuerung, Standards und Lernorten. In: Seifried, J./Bonz, B. (Hrsg.): Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Handlungsfelder und Grundprobleme. Baltmannsweiler.
Büchter, K./Kipp, M./Weise, G. (2000): Zur Vereinbarkeit von kritischem Anspruch und sozialhistorischer Rekonstruktion in der berufspädagogisch-historischen Forschung. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik (ZBW). 96. Jg., Nr. 4, 512-523.
Burger, A./Seidenspinner, G. (1979): Berufliche Ausbildung als Sozialisationsprozeß. München.
Calmbach, M. et al. (2012): Wie ticken Jugendlichen. Lebenswelten von Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren in Deutschland. SINUS Markt- und Sozialforschung GmbH, Berlin.
Chesi, V. (1966): Struktur und Funktion der Handwerksorganisation in Deutschland seit 1933. Berlin.
Deutsche Arbeitsfront (DAF) (Hrsg.)(1935): Die Betriebszelle. Amtliche Mitteilungen für die DAF-Walter des Gaues Hamburg. 2. Jg., Nr. 3, Gau Hamburg. In: StaHH 614-2/5 A11 „Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) Gau Hamburg. ‚Die Betriebszelle’, amtliches Mitteilungen für die DAF-Walter des Gaues Hamburg Nr. 1-4 und 6/1935 und Anordnungen für die DAF-Walter des Gaues Hamburg Nr. 1-3 und 5-15/1935 sowie Nr. 1/1936“.
Dreßen, W. (2001): Nationalsozialistische Handwerks-, Handels-, und Gewerbeorganisation (NS-Hago). In: Benz, W./Graml, H./Weiß, H. (Hrsg): Enzyklopädie des Nationalsozialismus. 4. Aufl. München, 607.
Erste Verordnung über den vorläufigen Aufbau des deutschen Handwerks (1934). In: Pätzold, G. (Hrsg.): Quellen und Dokumente zur Geschichte des Berufsbildungsgesetzes 1875–1981. Quellen und Dokumente zur Geschichte der Berufsbildung in Deutschland, Reihe A, Bd. 5. Köln, 272-276.
Franger, M. (1995): Berufsausbildung, Technikfelder und Selbstbestimmung. Einstellungen und Verhalten gewerblich-technisch Auszubildender in industriellen Metall- und Elektroberufen. Hier ist auch die politische Einstellung untersucht worden.
Gewande, W.-D. (2007): Historische Entwicklung der staatlich anerkannten Ausbildungsberufe im Handwerk und ihrer Ordnungsmittel von 1934 bis 2008 unter Einbeziehung der mit deutschen Ausbildungsberufen gleichgestellten österreichischen Lehrberufe und gleichwertigen Facharbeiterberufen aus der ehemaligen DDR. Online: http://netzwerk.bistech.de/datadir/server-1/materials/material_2158/genealogiehandwerksberufe.pdf (10-03-2017).
Hacker, W. (1986): Arbeitspsychologie. Bern.
Handwerkskammer (HWK) Hamburg (1973): Handwerkskammer Hamburg 1873–1973. Hamburg.
Heid, H. (2006): Werte und Normen in der Berufsbildung. In: Arnold, A./Lipsmeier, A. (Hrsg.): Handbuch der Berufsbildung. 2. Aufl. Wiesbaden, 33-43.
Heinz, W.R. (1995): Arbeit, Beruf und Lebenslauf. Eine Einführung in die berufliche Sozialisation. Weinheim/München.
Hochmuth, U./Meyer, G. (1969): Streiflichter aus dem Hamburger Widerstand 1933-1945. Berichte und Dokumente. Frankfurt a.M.
John, P. (1987): Handwerk im Spannungsfeld zwischen Zunftordnung und Gewerbefreiheit. Entwicklung und Politik der Selbstverwaltungsorganisationen des deutschen Handwerks bis 1933. WSI-Studie zur Wirtschafts- und Sozialforschung Nr. 62. Köln.
Kärtner, G. et al. (1984): Politische Sozialisation im Betrieb. In: Braun, F./Schäfer, H./ Schneider, H. (Hrsg.): Betriebliche Sozialisation und politische Bildung von jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. München, 17-33.
Kaufmann, K. (1937): Kein Betrieb darf fehlen! Aufruf des Gauleiters zum Leistungskampf der deutschen Betriebe. In: Wandsbeker Bote. In: StaHH 135–1-I-IV-7511 „Auszeichnungen von nationalsozialistischen Musterbetrieben“ (1936-1942).
Kipp, M./Miller-Kipp, G. (1995): Erkundungen im Halbdunkeln. Einundzwanzig Studien zur Berufserziehung und Pädagogik im Nationalsozialismus. Frankfurt a.M.
Knoblich, P. (1976): Die Ordnung des Handwerks in beiden deutschen Staaten. Würzburg.
Kohli, M. (1989): Institutionalisierung und Individualisierung der Erwerbsbiograhie. In: Brock, D. et al. (Hrsg.): Subjektivität im gesellschaftlichen Wandel. München.
KZ-Neuengamme (2010): Widerstand und Verfolgung in Hamburg 1933–1945. Online: http://www.offenes-archiv.de/de/WeitereAusstellungen/themenfokus-widerstand-hamburg.xml (15-05-2017).
Lambert, A. (2017): Die Berufsbildung im Nationalsozialismus in Hamburg – eine exemplarische Untersuchung der Ideologisierung im Spiegel der formalen und rechtlichen Dokumente der Berufsbildung des Malers. Bielefeld. (Im Erscheinen).
Lange, H. (2002): Sackgassen der Ideologiekritik oder Überlegungen zur berufs- und wirtschaftspädagogischen Geschichtsschreibung seit ’68. In: Eckert et al. (Hrsg.): Bilanzierungen. Schulentwicklung, Lehrerbildung und Wissenschaftsgeschichte im Feld der Wirtschafts- und Berufspädagogik. Frankfurt a.M., 73-97.
Lemberg, E. (1971): Ideologie und Gesellschaft. Eine Theorie der ideologischen Systeme, ihrer Struktur und Funktion. Stuttgart.
Lempert, W. (2002): Berufliche Sozialisation oder was Berufe aus Menschen machen. Eine Einführung. 2. Aufl. (Grundlagen der Berufs- und Erwachsenenbildung, Bd. 16). Baltmannsweiler.
Lempert, W. (2006): Berufliche Sozialisation. Persönlichkeitsentwicklung in der betrieblichen Ausbildung und Arbeit. Baltmannsweiler.
Lenk, K. (1971): Volk und Staat. Strukturwandel politischer Ideologien im 19. und 20. Jhd. Stuttgart.
Lepold, A. (1998): Der gelenkte Lehrling. Industrielle Berufsausbildung von 1933-1939. Frankfurt a.M.
Neuenschwander, M.P./Gerber, M. (2014): Schulische Vorbereitung auf die berufliche Sozialisation im Lehrbetrieb. School Preparation for Vocational Socialization in VET Companies. In: Unterrichtswissenschaft. Zeitschrift für Lernforschung. Nr. 42, H. 3, 244-260.
- A. (1934): Die Kontrolluhr verschwindet! In: StaHH 131-10II-269 „Ersetzung der Kontrolluhren durch Betriebsappelle, Bildung von Werkscharen (1934, 1936-1939)“.
- A. (1934): Die Kontrolluhr verschwindet! In: StaHH 131-10II-269 „Ersetzung der Kontrolluhren durch Betriebsappelle, Bildung von Werkscharen (1934, 1936-1939)“.
- A. (1934): Handel, Handwerk und Gewerbe in der deutschen Volkswirtschaft. In: „Völkischer Beobachter“. In: StaHH 135-1 I-IV-7488 „Arbeitsfürsorge in der NS-Zeit. Tätigkeiten der NS-Handwerksorganisation“.
- A. (1935): Amt für Handwerk und Handel wird umgebaut. In: „Hamburger Nachrichten“. In: StaHH 135-1 I-IV-7488 „Arbeitsfürsorge in der NS-Zeit. Tätigkeiten der NS-Handwerksorganisation“.
- A. (1936): Dreijähriger Neuaufbau im Handwerk. In: „Völkischer Beobachter“ (29.11.1936) In: StaHH 135-1-I-VI-7354 „Berichte und Stellungnahmen zur allgemeinen Lage des Handwerks“ (1922–1942).
- A. (1942): Kämpfende und arbeitende Front … . In: „Hamburger Anzeiger“. In: StaHH 135-1-I-VI-7354 „Berichte und Stellungnahmen zur allgemeinen Lage des Handwerks“ (1922–1942).
Pätzold, G. (1980): Quellen und Dokumente zur betrieblichen Berufsbildung 1918–1945. Quellen und Dokumente zur Geschichte der Berufsbildung in Deutschland, Reihe A, Bd. 5. Köln.
Pätzold, G. (1989): Berufsbildung. In: Langewiesche, D./Tenorth, H.-E. (Hrsg.): Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte. Die Weimarer Republik und die nationalsozialistische Diktatur. Bd. IV 1918–1945. München, 259-306.
Raber, W. (1997): Antisemitische und Ausländerfeindliche Einstellungen. In: Schumann, S./Winkler, J. (Hrsg.): Jugend, Politik und Rechtsextremismus in Rheinland-Pfalz. Ergebnisse eines empirischen Modellprojekts. Frankfurt, 145-162.
Reichsbürgergesetz (15.09.1935). In: DocumentArchiv.de – Historische Dokumenten- und Quellensammlung zur deutschen Geschichte ab 1800 (2004) (Hrsg.). Online: http://www.documentarchiv.de/ns/nbgesetze02.html (14-03-2017).
Richter, K./Jahn, R. (2015): Was willst Du denn da? – Entwicklung beruflicher Identität in geschlechtsunkonventionellen Berufen – eine Einzelfallstudie. In: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Ausgabe 29, 1-25. Online: http://www.bwpat.de/ausgabe29/richter_jahn_bwpat29.pdf (15-12-2015).
Schneider, M. (1999): Unterm Hakenkreuz. Arbeiter und Arbeiterbewegung 1922 bis 1939. Bonn.
Schröter, T./Eckert, M. (2014): Neue Anforderungen und neue Wege der betrieblichen Berufsausbildung. In: Berufsbildung. Zeitschrift für Praxis und Theorie in Betrieb und Schule. Nr. 68, H. 145, 11-12.
Smelser, R. (1988): Hitlers Mann an der „Arbeitsfront“. Robert Ley. Eine Biographie. Paderborn.
StaHH 131-10 II-340 „Richtlinien für den Leistungskampf der öffentlichen Betriebe 1937-1939“.
StaHH 131-10II-269 „Ersetzung der Kontrolluhren durch Betriebsappelle, Bildung von Werkscharen“ (1934, 1936-1939).
StaHH 135-1-I-VI-7354 „Berichte und Stellungnahmen zur allgemeinen Lage des Handwerks“ (1922–1942).
StaHH 377-11-140 „Betriebsappelle 1934-1944 – Schlachthofverwaltung“.
StaHH 377-11-238 „Nationaler Aufbau: Propaganda der NSDAP 1933-1934“ – Schlachthofverwaltung.
Volpert, W. (1987): Psychische Regulation von Arbeitstätigkeiten. In: Kleinbeck, U./Rutenfranz, J, (Hrsg.): Arbeitspsychologie. Themenbereich D/III, Bd. 1, Enzyklopädie der Psychologie. Göttingen, 1-42.
Weinbrenner, P. (1989): Beruf und Arbeit im Politikunterricht beruflicher Schulen – Zur Neukonzeption des Politikunterrichts. In: Weinbrenner, P. (Hrsg.): Politische Bildung an beruflichen Schulen zwischen Kammerprüfung und eigenständigem Bildungsauftrag. Ergebnisse der Hochschultage Berufliche Bildung 1988. Bd. 12, Hochschule & Berufliche Bildung. Alsbach, 231-266.
Weinbrenner, P. (1992): Der Wandel der Politikdidaktik in der Berufsschule (1945–1991). In: Geißler, K. A. et al. (Hrsg.): Von der staatsbürgerlichen Erziehung zur politischen Bildung. 3. Berufspädagogisch-historischer Kongress 9.-11. Oktober 1991 in München, 276-320.
Wernet, W. (1963): Kurzgefasste Geschichte des Handwerks in Deutschland. 4. Aufl. Dortmund.
Windolf, P. (1981): Berufliche Sozialisation. Zur Produktion des beruflichen Habitus. Stuttgart.
Winkler, H. A. (1972): Mittelstand, Demokratie und Nationalsozialismus. Die politische Entwicklung von Handwerk und Kleinhandel in der Weimarer Republik. Köln.
Zedler, R. (2007): Politische Bildung in der dualen Berufsausbildung. In: Bundeszentrale für politische Bildung (bpb): Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ): Politische Bildung. Online: http://www.bpb.de/apuz/30317/politische-bildung-in-der-dualen-berufsausbildung?p=all (20-02.2017).
Zentralverband des deutschen Handwerks (ZDH) (o. J.): Das Handwerk im 20. Jahrhundert. Eine historische Bilanz handwerklicher Selbstverwaltung. Online: http://www.zdh.de/fileadmin/user_upload/daten-fakten/geschichte/das-handwerk-20-jahrhundert.pdf (06-03-2017).
[1] Die Berufsschule ist „bei weitem kein gleichberechtigter Partner der Ausbildungsbetriebe“ (vgl. Lempert 2002, 11/160).
[2] Unter betrieblicher Berufsbildung zählt „das für Industrie, Handel, Haus- und Landwirtschaft gültige Berufsbildungsgesetz (BBiG) des Bundes sowie die für die betriebliche Berufsbildung im Handwerk zuständige Handwerksordnung (HwO) […] die Berufsausbildungsvorbereitung, die Berufsausbildung, die berufliche Fortbildung und Umschulung“ (Büchter 2015, 91).
[3] Der folgende Beitrag fokussiert in den weiteren Ausführungen nur diesen Bezugspunkt der betrieblichen Berufsbildung – den Lernort.
[4] Rechte und Pflichten des Ausbildenden sind im Berufsbildungsgesetz (BBiG §14) festgehalten. So heißt es unter Punkt eins „Ausbildende haben […] dafür zu sorgen, dass Auszubildende charakterlich gefördert sowie sittlich und körperlich nicht gefährdet werden“ (BBiG §14).
[5] Unter Deutungsmuster versteht Arnold (1983, 170) „die mehr oder weniger zeitstabilen Sichtweisen und Interpretationen von Mitgliedern einer sozialen Gruppe, die diese zu ihren alltäglichen Handlungs- und Interaktionsbereichen entwickelt haben. Im einzelnen handelt es sich hierbei um ein Orientierungs- und Rechtfertigungspotential von Alltagswissensbeständen in der Form grundlegender Situations-, Beziehungs- und Selbstdefinitionen, in denen das Individuum seine Identität präsentiert“.
[6] Zur beruflichen Bildung im Nationalsozialismus in Hamburg und zur Ideologisierung der Berufsbildung des Malers im Spiegel der formalen und rechtlichen Dokumente siehe Lambert (2017). In der Dissertation wird berufsfeld- und regionalspezifisch untersucht, wie die nationalsozialistische Ideologie in der beruflichen Bildung umgesetzt worden ist und warum sie dort eingesetzt wurde, d. h. welche nationalsozialistischen Ziele sie verfolgte. Hierzu erfolgt eine sozial-, regional-, ideen- und berufshistoriografische Analyse, die einen kriteriengeleiteten quellenbasierten Beitrag zur Historiografie der Berufsbildung bildet.
[7] Z. B. die arbeitspsychologische Handlungstheorie von Volpert (1987) und Hacker (1986), die soziologische Theorie der Produktion des beruflichen Habitus (in Anlehnung an Bourdieu) von Windolf (1981) oder die Modernisierungs- und Individualisierungstheorie z. B. von Kohli (1989) (vgl. Heinz 1995, 47ff.; vgl. Lempert 2002).
[8] Z. B. Franger, M. (1995): Berufsausbildung, Technikfelder und Selbstbestimmung. Einstellungen und Verhalten gewerblich-technisch Auszubildender in industriellen Metall- und Elektroberufen. Hier ist auch die politische Einstellung untersucht worden.
Calmbach, M. et al. (2012): Wie ticken Jugendlichen. Lebenswelten von Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren in Deutschland. SINUS Markt- und Sozialforschung GmbH, Berlin.
Raber, W. (1997): Antisemitische und Ausländerfeindliche Einstellungen. In: Schumann, S./Winkler, J. (Hrsg.): Jugend, Politik und Rechtsextremismus in Rheinland-Pfalz. Ergebnisse eines empirischen Modellprojekts. Frankfurt, 145-162.
[9] Als Ursache dieses Problems sieht Weinbrenner (1989, 1992) das sogenannte „Kammernsyndrom“ (vgl. Weinbrenner 1989, 243; vgl. Weinbrenner 1992, 304), denn „das Berufsschulzeugnis, in dem das Fach Politik mit Abschlußnote auftaucht, [ist] für das Bestehen der Kammerprüfung und die Frage der beruflichen Übernahme und Weiterbeschäftigung sowie für spätere Bewerbungen und Aufstiegschancen ohne jede Relevanz“ (Weinbrenner 1989, 243).
[10] Zur weiteren Informationen der Ideologisierung des Handwerks insbesondere des Malerhandwerks im Nationalsozialismus in Deutschland und Hamburg siehe Lambert (2017).
[11] Bei der Rekonstruktion wird auf Grund der Vielzahl an wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen seit der nationalsozialistischen Diktatur chronologisch nur auf drei Entwicklungen eingegangen, die wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Veränderungen mit sich brachten. Für weiterführende Literatur siehe Wernet 1963; Chesi 1966 und Knoblich 1976.
[12] Eine klare Definition, was unter dem Verstoß zu verstehen ist, gibt es nach Knoblich (1976) nicht.
[13] Es handelt sich hierbei um die Voraussetzung für das Ausüben eines Gewerbes und das Ausbilden von Lehrlingen. Mit der Einführung der Gewerbefreiheit (seit 1810 in Preußen, 1869 in den Norddeutschen Ländern und 1871 im gesamten Reich) wurde diese Regelung aufgehoben. Seitdem war jeder Gewerbescheinbesitzer berechtigt, ohne Meisterprüfung Arbeiter einzustellen und auszubilden. Der „kleine Befähigungsnachweis“ (nur mit erfolgreich abgeschlossener Meisterprüfung darf in jedem Handwerk ausgebildet werden) wurde 1908 auf der Jahrestagung des Kammertages in Köln beschlossen. (Vgl. Wernet 1963; vgl. Chesi 1966; John 1987)
[14] Es handelt sich um die gesetzliche Grundlage für die britische und französische Zone (vgl. Chesi 1966, 47), die Amerikaner führten nach einigen Anfangsschwierigkeiten 1948 die Gewerbefreiheit wieder ein. In der sowjetischen Zone hingegen wurde die kommunistische Planwirtschaftsideologie umgesetzt, die sämtliche Selbstverwaltungsstrukturen des Handwerks auflöste (vgl. ZDH o. J., 5ff.).
[15] Zur Ideologiekritik und der berufs- und wirtschaftspädagogischen Geschichtsschreibung nach 1968 siehe Lange (2002).
[16] Für weitere ausführlichere Informationen zu Formen und Funktionen politischer Systeme bzw. der NS-Ideologie in Deutschland siehe Lambert (2017).
[17] Der Artikel bezieht sich auf das Ergebnis der amtlichen Erhebung im Jahr 1926.
[18] Auf diesem Kongress im Juli 1938 in Berlin waren 1000 Vertreter aus 48 Ländern anwesend, um ihre Erfahrungen in der Berufsbildung untereinander auszutauschen (vgl. Arnold 1938, in StaHH 614-2/5 A13).
[19] Betriebsappelle im Nationalsozialismus waren eine Versammlung des Betriebsführers und der gesamten Belegschaft in regelmäßigen Abständen zum Informationsaustausch bzw. zur politischen Ideologisierung.
[20] Der Aufruf des Senats bezog sich in der Akte auf öffentliche Einrichtungen.
[21] Titel des Artikels: „Die Kontrolluhr verschwindet!“.
[22] Deutsche Arbeitsfront (DAF) (Hrsg.)(1935): Die Betriebszelle. Amtliche Mitteilungen für die DAF-Walter des Gaues Hamburg. 2. Jg., Nr. 3, Gau Hamburg.
[23] In der Akte befinden sich viele Protokolle des „Schlacht- und Viehmarkts Hamburgs“ zu den thematischen Inhalten der Betriebsappelle seit ihrer Einführung 1934.
[24] Zur Darstellung des Widerstandes in Hamburg gegenüber dem Nationalsozialismus siehe das Buch „Streiflichter aus dem Hamburger Widerstand“ von Ursula Hochmuth und Gertrud Meyer (1969). Zum Widerstand in Hamburg existiert bis heute keine wissenschaftlich fundierte Gesamtdarstellung (vgl. KZ-Neuengamme 2010).
[25] Darunter sind verschiedene Stufen kritisch-politischer Bildung zu verstehen. Es geht zum einen über eine Sensibilisierung für das Thema, zum anderen um die Aufdeckung und Überwindung von Macht- und Herrschaftsprozessen. In der betrieblichen (Aus)Bildung ist unter kritisch-politischer Bildung mithin auch die Emanzipation als Befreiung aus (politisch-orientierten) beruflichen Mustern zu verstehen (Befreiung/Widerstand aus Anpassungs- und Unterwerfungsprozessen).
Zitieren des Beitrags
Lambert, A. (2017): Betriebliche (Handwerks)Bildung im Nationalsozialismus – Eine kritisch-historiografische Untersuchung der nationalsozialistischen Interessen und der NS-Ideologie (im Handwerk) in Hamburg (1933-1945). In: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Ausgabe 32, 1-29. Online: http://www.bwpat.de/ausgabe32/lambert_bwpat32.pdf (22-06-2017).